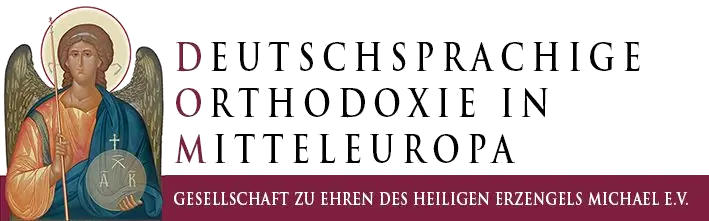Jahreskalender der Heiligen auf der DOM-Synaxis Ikone
Landelin von Ettenheimmünster, + ca. 640, 21. September

Landelin war der Legende nach ein Fürstensohn und Mönch aus Irland, der seine Heimat verließ, um ein Einsiedlerleben zu führen. Er kam zur Zeit des fränkischen Königs Dagobert I. und des alamannischen Herzogs Gunzo (um 635) in die Ortenau in Baden[1] , wo er einige Zeit bei einem Mann namens Edulph lebte. Dann aber zog er sich tiefer in die Einsamkeit des Waldes bei Ettenheimmünster zurück und wirkte als erster Glaubensbote in dieser Gegend. Das Wild kam oft an seine Hütte und fraß dem frommen Mann aus der Hand. Dies verdross den Jäger des auf der Gysenburg wohnenden alemannischen Adligen Gisko. Er hetzte seine Hunde auf ihn, doch diese kauerten sich winselnd vor Landelin nieder und rührten ihn nicht an. Nun glaubte der Jäger, einen Zauberer vor sich zu haben und schlug dem Missionar den Kopf ab.
Dies geschah der Überlieferung nach im Jahre 640 in der Zeit des Alamannenherzogs Leuthari II. am 21. oder 22. September. An dem Ort, wo Landelins Blut in den Boden drang, entsprangen fünf heilkräftige Quellen: eine am Kopf und je eine an beiden Händen und Füßen. Vorbeikommende Frauen – nach mancher Überlieferung die Frau und die Töchter von Edulph – fanden den Leichnam und fertigten eine Bahre, um Landelin zu einem Begräbnisplatz zu tragen. Eine dieser Frauen war blind und wurde, nachdem sie die Leiche berührt hatte und sich dann mit ihren blutbeschmierten Händen über die Augen strich, wieder sehend. Als die Frauen mit dem Leichnam an die Stelle kam, an der sich heute die Pfarrkirche von Münchweier befindet, war ihnen der Leichnam so schwer geworden, dass sie eine Rast einlegen mussten. Als sie weitergehen wollten, war der Tote so schwer, dass sie ihn nicht mehr hochheben konnten; deshalb begruben sie ihn hier.
An der Stelle der Klause von Landelin in Ettenheimmünster ereigneten sich nach seinem Tod viele Wunder, weswegen sich dort Mönche niederließen. Um 728 erweiterte der Straßburger Bischof Widegern (Widrigen) die kleine Einsiedelei zu einer „cella monachorum“, dem Klösterchen „Mönchszell“ (heute Münchweier), mit einem großen Badhaus und einer vielbesuchten Wallfahrtskirche.
Im Hochaltar befinden sich Reliquien des Heiligen.
Bischof Etto von Straßburg, bestätigte die Stiftung seines Vorgängers, verpflichtete die Mönche auf die Ordensregel des hl. Benedikt und ließ um 763 ein neues Kloster erbauen, das nach ihm „Monasterium Ettonis“ (Kloster des Etto) genannt wurde.
Links
https://orthpedia.de/index.php/Landelin_von_Ettenheimmünster
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Landelin_von_Ettenheimmuenster.html
Quellen: Wiki, Oekumenisches Heiligenlexikon, Orthpedia, Mönch Melitons Heiligenviten, Vladyka Hiobs Kurzfassungen, Vater Alexandrus beiden Bände, der Tagungsband der russischen Konferenz in Berlin, einige Monographien.