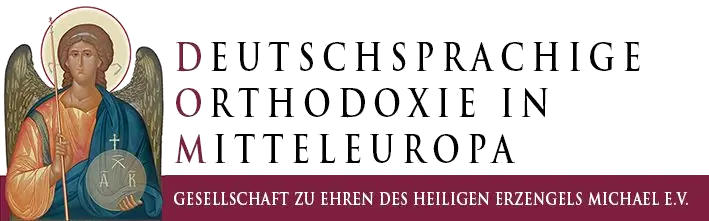Jahreskalender der Heiligen auf der DOM-Synaxis Ikone
Nicetius von Trier 513-566, 25. Juli/ 3. Oktober

Zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert erlebte das Gebiet um Trier unruhige Zeiten. Während der Völkerwanderung bedrohten verschiedene germanische Stämme von Norden her die Existenz der römischen Herrschaft auf der rechten Rheinseite, darunter Vandalen und Hunnen. Im Jahr 455, nach der Einnahme der Stadt durch die von Westen her angreifenden Franken, brach deren Verwaltungsstruktur endgültig zusammen. Die alte Augusta Treverorum, Hauptstadt der römischen Herrschaft in Germanien, lag in Schutt und Asche. Ab 490 war die Stadt offiziell in das Merowingerreich eingegliedert.
Damals wurde Nicetius in Reims als Sohn einer gallorömischen Adelsfamilie geboren. Das Kind wurde dem Abt des dortigen Klosters zur Ausbildung anvertraut. Nach dessen Tod wählte man Nicetius an seiner Stelle. Trier, etwa 200 km von Reims entfernt, war ein Trümmerhaufen und nur noch dünn besiedelt. Ruinen, Bettler, Hungersnöte und Missernten prägten das Bild. In den zerstörten Kirchen gab es keine Priester mehr. Angesichts dieser Umstände schickte der fränkische König Theuderich Geistliche nach Trier, um das kirchliche Leben dort wieder aufzubauen. Der gute Ruf von Abt Nicetius als Wohltäter der Armen und als mutiger Kritiker selbst des Königs veranlasste diesen, Nicetius im Jahr 525/6 als Bischof von Trier einzusetzen.
Auch unter Theuderichs Nachfolger (und Halbbruder) Chlothar I scheute sich Nicetius nicht, dessen Ungerechtigkeit anzuprangern. Als der König einmal in Trier an der Liturgie teilnehmen wollte, weigerte sich Nicetius, den Gottesdienst zu beginnen, bevor nicht der König und die von ihm geschützten Adeligen, die Nicetius wegen begangener Verbrechen exkommuniziert hatte, die Kirche verließen. Er verurteilte mit zur damaligen Zeit ungewöhnlicher Härte Chlothars Verbindung mit der Witwe des Enkels eines anderen Halbbruders als „inzestuös“ und soll deshalb von einer Synode abgesetzt worden sein, deren Mitglieder nicht den Mut hatten, diese Beziehung zu kritisieren.
Hierfür wurde er von Chlothar sogar in die Verbannung geschickt. Erst König Sigibert I holte ihn nach 561 nach Trier zurück. Während seiner Amtszeit reformierte Nicetas die Diözese. Er baute den Trierer Dom wieder auf, renovierte mehrere Kirchen, kümmerte sich aber auch um die moralische Verbesserung des Klerus, die Förderung des Mönchtums und die Einberufung von und Teilnahme an mehreren Synoden. Dabei vernachlässigte er auch das einfache Volk nicht und griff ein, wenn es vom Adel unterdrückt wurde.
Als Mitglied der alten gallo-romanischen Adelsschicht war Nicetius dennoch kein Gegner der Franken. Er protestierte jedoch vor allem gegen das unmoralische Leben der herrschenden Klasse und der Bevölkerung. In einem Brief von 549/550 rügte Nicetius sogar den byzantinischen Kaiser Justinian den Großen (527–565) und forderte ihn auf, den Irrlehren des Nestorius und Eutychius abzuschwören und die Verfolgung der Rechtgläubigen einzustellen. Durch zahlreiche Briefe an die langobardische Königin Chlodoswinda (eine Schwester Chlothars) versuchte er, deren Mann, den König der Langobarden, für den wahren Glauben zu gewinnen. Er unterstützte die Christianisierung der Bevölkerung mit Hilfe der örtlichen Großgrundbesitzer. Im Jahr 566, dem Jahr seines Todes, war die Stadt Trier wieder aufgeblüht. Die Kirchen waren renoviert worden und viele Priester und Kaufleute waren in die Stadt zurückgekehrt. Die Stadt, die unter den Römern als kaiserliche Residenz und wichtiger Bischofssitz in Gallien von großer Bedeutung gewesen war, konnte durch des Bischofs Einsatz unter fränkischer Herrschaft ihre frühere religiöse Stellung wieder erlangen. Seine Reliquien befinden sich in Trier.
Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Nicetius
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Niketius_von_Trier.htm
https://www.trierer-original.de/Trierer-Originale/Bischof-Nicetius-51640.html
Quellen: Wiki, Oekumenisches Heiligenlexikon, Orthpedia, Mönch Melitons Heiligenviten, Vladyka Hiobs Kurzfassungen, Vater Alexandrus beiden Bände, der Tagungsband der russischen Konferenz in Berlin, einige Monographien.