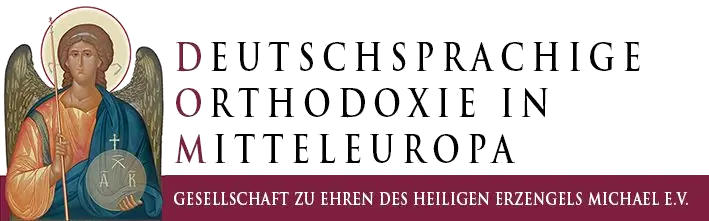Jahreskalender der Heiligen auf der DOM-Synaxis Ikone
Walburga von Heidenheim, 710 – 779, 25. Februar

Als Tochter des Fürsten Richard von England und Schwester der Heiligen Willibald und Wunibald begab sie sich, als nach dem Tod ihrer Mutter der Vater und die Brüder ihre Pilgerreise nach Rom antraten, schon mit zehn Jahren in das Kloster Wimborne. Dieses war bekannt für seine Gelehrsamkeit und gute Ausbildung für Frauen aus der Oberschicht. 26 Jahre lang bereitete ihre Äbtissin Tetta sie auf ihre Aufgabe als Missionarin vor, eine Aufgabe, die sie aufgrund der Erfahrungen ihrer Brüder anstrebte.
Mitte des 8. Jahrhunderts folgte sie dann tatsächlich, gemeinsam mit Lioba und anderen Nonnen, dem Ruf des Heiligen Bonifatius. Mehrere Jahre verbrachte sie in dem von der heiligen Lioba geleiteten Kloster Bischofsheim, wo sie mit Hilfe von drei Ähren auf wundersame Weise einen Säugling vor dem Verhungern gerettet haben soll.
Nach Wunibalds Tod kam Walburga 761 in das von ihrem Bruder gegründete Kloster Heidenheim und teilte es nach angelsächsischem Vorbild in ein Mönchs- und ein Nonnenkloster; beide unterstellte sie der benediktinische Regel. Tag und Nacht verharrte sie im Gebet, fastete ununterbrochen und wachte die Nächte hindurch. Wegen ihrer Missionstätigkeit, durch die sie die missionarische Rolle von Nonnen in Deutschland stärkte, lebte sie nicht in strenger Klausur und bat deshalb Christus, der sie im Glauben stark gemacht hatte, sie auch am Leibe rein zu erhalten.
Gemeinsam mit ihrem Bruder Willibald vergewisserte sie sich 777 der Heiligkeit ihres Bruders Wunibald, ließ die heiligen Reliquien in die Krypta des Klosters legen und verfasste gemeinsam mit der ihr verwandten Nonne Hugeburg eine Biographie beider Brüder.
Auch aus ihrer Zeit als Äbtissin des Klosters sind mehrere von ihr gewirkte Wunder überliefert. Eines Nachts weigerte sich zum Beispiel der Türhüter der Kirche, in der Walburga betete, ihr mit einer Fackel den Heimweg zu leuchten. Als sie darum später als erhofft zurückkam, musste sie hungrig zu Bett gehen. Als um Mitternacht das Zeichen zum Gottesdienst ertönte entstand plötzlich eine wunderbare Helle, welche alle Schlafgemächer und selbst den Boden durchdrang. Die hl. Äbtissin pries den Herrn und dankte Ihm mit lauter Stimme, dass Er sich würdigte, durch die milden Strahlen seiner Barmherzigkeit die Finsternis der Schrecken zu verscheuchen.
Als der hl. Wunibald im Jahre 761 entschlief ging sie eines nachts, im Geiste dazu angeregt, zu dem Haus eines reichen Grundherrn zu Hohentruhendingen dessen Tochter, wie sie wusste, im Sterben lag. Als man sie vor der Türe seines Hauses stehen sah, ohne sie zu erkennen, wurden auf Befehl des Hausherrn die Wachhunde auf sie losgelassen. Sie aber sprach: “Der mich unversehrt und ohne dein Wissen hierhergeführt hat, wird mich auch unversehrt wieder heimführen, ja Er wird auch, wenn du mit allen deinen Kräften an Ihn glaubst, die Gabe der Heilung in dein Haus einführen.” Die Heilige ließ sich in das Gemach der Sterbenskranken führen, um welche die betrübten Eltern bitterlich weinten, und brachte die Nacht unter inständigem Gebet im Krankenzimmer zu. Bei Morgengrauen stellte sie den hocherfreuten Eltern ihre Tochter völlig gesund vor. Die Eltern baten sie um ihre unablässigen Gebete und wollten sie mit Geschenken beehren. Sie aber nahm nichts an und kehrte Gott preisend zu den Ihrigen zurück. Ihr nüchternes Leben in Demut und Selbstverleugnung war sowohl für Nonnen und Mönche als auch für Laien Vorbild und überzeugendste Predigt. Walburga starb am 25. Februar 779 (oder später, im Jahr 790) und wurde in Heidenheim beigesetzt. Später wurden ihre Reliquien an verschiedene andere Stätten gebracht, bis sie schließlich in Berg bei Köln, dem späteren Walberberg, in der Pfarrkirche zur Ruhe kamen. Aus ihrem Sarg fließen Tropfen, das so genannte Walburgisöl, das als wundertätig gilt.
Links
https://orthpedia.de/index.php/Walburga_von_Eichstätt
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienW/Walburga.htm
Quellen: Wiki, Oekumenisches Heiligenlexikon, Orthpedia, Mönch Melitons Heiligenviten, Vladyka Hiobs Kurzfassungen, Vater Alexandrus beiden Bände, der Tagungsband der russischen Konferenz in Berlin, einige Monographien.