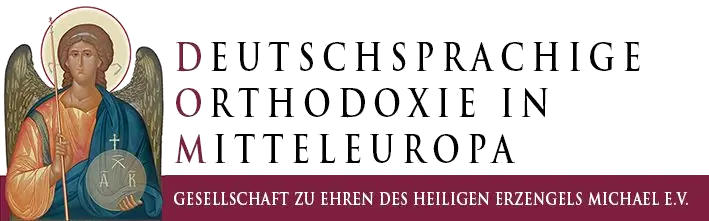Jahreskalender der Heiligen auf der DOM-Synaxis Ikone
Wunibald von Heidenheim 701-761, 18. Dezember

Wunibald wurde in Wessex, England, als älterer Bruder des Heiligen Willibald in einer fürstlichen christlichen Familie geboren. Während sein Bruder ins Kloster gebracht wurde, blieb Wunibald daheim. Um 720 unternahm er unter Verzicht auf sein väterliches Erbe mit seinem Vater und Bruder eine Pilgerreise nach Rom. Aufgrund der großen Strapazen dieser Reise verstarb der Vater In Lucca. Während Willibald in Begleitung mehrerer Freunde ins Heilige Land weiterreiste, blieb Wunibald in Rom, wahrscheinlich wegen gesundheitlicher Probleme. Er erhielt eine theologische Ausbildung und wurde Mönch im Benediktinerkloster San Paolo fuori di Mura. Später trat er in das Kloster Montecassino ein, wo auch Willibald inzwischen Mönch geworden war. Einige Quellen sprechen von einer Rückkehr beider Brüder nach England, und von ihrer Berufung durch ihren Onkel Bonifatius von dort aus. Andere lassen sie in Rom geblieben und im Jahr 738 oder 739 durch Bonifatius bei dessen dritter Romreise auf der Suche nach Hilfskräften aufgefordert worden sein, ihn bei seiner Missionsarbeit im heutigen Deutschland zu unterstützen. Mit dem Segen von Papst Gregor III. (731–741) wurden beide von Bonifatius zu Priestern geweiht. Ab 739 wirkte auch Wunibald als Missionar im von seinem Bruder verwalteten Missionszentrum Sülzenbrücken bei Erfurt. Ein vorübergehendes Bistum in Erfurt hat vielleicht zwischen 742 und 755 bestanden, wurde aber kurz nach dem Tod von Bonifatius wieder aufgelöst. Später, wahrscheinlich ab 744, ging Wunibald als Missionar in die Gegend um Amberg nach Bayern, und ab 747 zu Bonifatius nach Mainz. Selbst sehr asketisch lebend, waren ihm unmäßig Wein trinkende Mönche ein Greuel. Darum blieb er nie lange im Rheinland und zog die wilden Landstriche vor. Später gründete Wunibald mit Hilfe seines Bruders Willibald, der inzwischen Bischof von Eichstätt geworden war, das Benediktinerkloster Heidenheim in dessen kanonischem Gebiet, gab Anweisungen zur Urbarmachung des noch ganz unberührten Landes, vertrieb durch sein Gebet die dort verbreiteten giftigen Schlangen und rottete das Unkraut des Heidentums, welches hier noch üppig sprosste, gewissenhaft aus. Zusätzlich bemühte er sich, auch unter Lebensgefahr, um die Bekehrung nur dem Namen nach christlicher Priester, die mehr der Hurerei und der Unmäßigkeit als dem Gottesdienst ergeben waren. Eigentlich wäre er sehr gern nach Montecassino zurückgekehrt, doch sein Bruder überredete ihn, als Abt in Heidenheim zu bleiben. Hier zelebrierte der Heilige, wenn möglich täglich die Göttliche Liturgie, oder nahm zumindest an ihr Teil, und bemühte sich um Mildtätigkeit gegen die Armen und Notleidenden. Daneben erbaute viele Kirchen im ganzen Land.
Durch fortgesetzte Bußanstrengungen in seinen körperlichen Kräften aufgerieben, starb er nach herzlichen Ermahnungen seiner Mitbrüder am 18 Dezember im Alter von 60 Jahren, mit den Worten: „In Deine Hände befehle ich meinen Geist. “ Nach seinem Hinscheiden fingen die Glocken von selbst an zu läuten, die Kerzen entzündeten sich von selbst, und ein himmlischer Wohlgeruch erfüllte das ganze Haus.“
Nach seinem Tod um 761 übernahm seine Schwester Walburga nach fränkischem Lehnsgesetz das zum Doppelkloster erweiterte Kloster und leitete dort als Äbtissin den Nonnenkonvent. Angesichts der großen Zahl angelsächsischer Pilger wurde die Kirche des Klosters Heidenheim zwischen 776 und 777 umgebaut und vergrößert. Ein Jahr später, bei ihrer Weihe, stellten die beiden Geschwister (Willibald und Walburga) die Heiligkeit des Lebens ihres Bruders Wunibald fest, dessen sterbliche Überreste sie 16 Jahre nach seinem Hinscheiden in die Ewigkeit unversehrt auffanden. Sie liegen in der Krypta der neu erbauten Kirche.
Links
https://orthpedia.de/index.php/Wunibald_von_Heidenheim
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienW/Wunibald_von_Heidenheim.html
Quellen: Wiki, Oekumenisches Heiligenlexikon, Orthpedia, Mönch Melitons Heiligenviten, Vladyka Hiobs Kurzfassungen, Vater Alexandrus beiden Bände, der Tagungsband der russischen Konferenz in Berlin, einige Monographien.