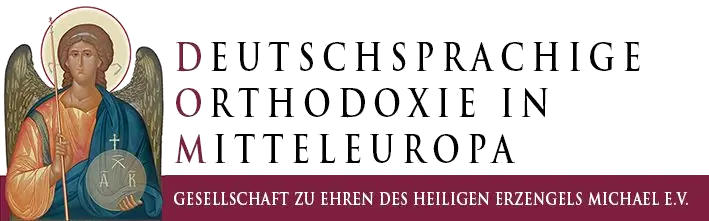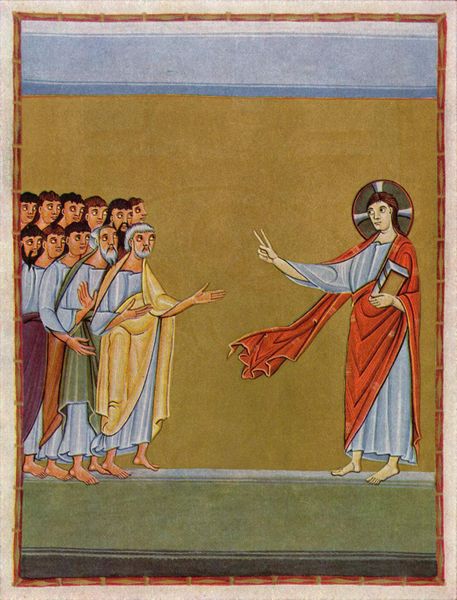Entwicklung und Bestandsaufnahme von der Vorkriegszeit bis heute
Ein Text von Erzpriester Johannes Nothhaas
Situation
Waren vor dem 2. Weltkrieg orthodoxe Kapellen und Kirchen die Versammlungsstätten orthodoxer Christen der gehobenen Gesellschaft an Kurorten und von Gesandtschaftspersonal der orthodoxen Völker, so veränderte sich diese Zusammensetzung der an den Gottesdiensten Teilnehmenden mit der Einwanderung von Gastarbeitern aus den orthodoxen Ländern in den westeuropäischen Ländern ab den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zusehends.

Überall in den westdeutschen Städten entstanden nationale orthodoxe Gemeinden, die von den Kirchen ihrer Heimat mit Geistlichen und schließlich auch mit Bischöfen versorgt wurden. Aus pastoralen Gründen war es notwendig, dass in diesen Gemeinden die Sprache der Liturgie die der Kirche in der Heimat war. Die Folge war, dass die nationalen Kirchen eine jede ihren Bischof oder Metropoliten zur Organisation für diese Gemeinden entsandten, die z.T. die Verantwortung ihrer orthodoxen Gemeinden in mehreren Ländern Westeuropas übernahmen. Dieses Nebeneinander mehrerer orthodoxer Bischöfe in einem Lande wie Deutschland oder Frankreich führte aus seelsorgerlichen Gründen zu einer nationalen Ausprägung dieser Gemeinden, was den Zugang nichtorthodoxer Christen zum universalen orthodoxen Erbe allein wegen der Sprachbarriere erheblich erschwerte.
Erkenntnis
Unter der pastoralen Versorgung der eigenen Landsleute trat das Zeugnis der Orthodoxie für die ungebrochene Tradition der Alten Kirche des 1. Jahrtausends in den Hintergrund. Gläubige aus den abendländischen Traditionen des Christentums, die den Zugang zur Orthodoxie gefunden und die Konversion in sie vollzogen hatten, empfanden bei allem Verständnis für die pastorale Situation hier einen Nachholbedarf.
Schlussfolgerung
Einer der Ersten, der diesen Mangel des orthodoxen Zeugnisses – bedingt durch die seelsorgerliche Aufgabe – notvoll empfanden und nach Abhilfe suchten, war der nachmalige Erzpriester Sergius Heitz, der als Konvertit aus dem römisch-katholischen Frankreich, nach dem 2. Weltkrieg den Weg in die Orthodoxe Kirche gefunden hatte (Eher war es noch der hl. Johannes von Schanghai, der sowohl V. Sergius wie auch V. Gabriel Bultmann anregte, in ihrer Muttersprache die Dienste zu halten).

Er kam 1956 nach Deutschland und gründete 1958 in Düsseldorf eine deutschsprachige Gemeinde, um den Zugang zum orthodoxen Erbe auch für die Christen dieses Landes zu ermöglichen. Sein Ziel war eine germanophone Orthodoxie für die zukünftigen Generationen der eingewanderten orthodoxen Christen. Er übersetzte die Liturgien, Stundengebete und die meisten Mysterien ins Deutsche, die dann als erster Band mit dem Titel „Der Orthodoxe Gottesdienst“ 1966 erschienen. Ab 1962 gab er das theologische Journal „Orthodoxie Heute“ heraus, das an alle theologischen Fakultäten Westdeutschlands versandt worden war. Er gründete den deutschen Zweig der „Orthodoxen Fraternität“, eine Gemeinschaft orthodoxer Christen, um den Kontakt der verschiedenen nationalen orthodoxen Kirchen untereinander und zu deutschen an der Orthodoxie interessierten Christen herzustellen und zu vertiefen. Kurz gesagt, er ist ab den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Pionier der deutschsprachigen Orthodoxie, mit frühen und breit gefächerten Kontakten zu den orthodoxen Universitäten in Frankreich, USA, Griechenland, Rumänien und Finnland, die seine Arbeit aus der Ferne unterstützten.
Der Weg
Durch seinen Impuls sind vorwiegend deutschsprachige orthodoxe Gemeinden in Düsseldorf, Köln, Würzburg, Geilnau/Lahn und Mainz und nach seinem Tod 1998 an anderen Orten entstanden, die diese Aufgabe übernommen haben und weiter für die Zukunft anstreben.1 Die Mehrzahl der orthodoxen Gemeinden in den Großstädten unseres Landes ist jedoch in ihren Gottesdiensten vorwiegend nationalsprachlich ausgerichtet. Und das wird sich auch nicht ändern, solange es keine deutschsprachigen orthodoxen Geistlichen gibt, d.h. junge Männer, die das Studium der orthodoxen Theologie an einer orthodoxen Ausbildungsstätte im Ausland mit dem Erlernen der dortigen Sprache oder einer anderen Möglichkeit in unserem Land auf sich nehmen. Noch sind die deutschsprachigen orthodoxen Gemeinden klein, die kaum oder nur mit großer Anstrengung einen Priester mit Familie tragen können, so dass die deutschen Geistlichen meistens einen eigenen Beruf zum Lebensunterhalt sich schaffen müssen. Das ist ein zusätzliches Opfer, das den Weg in die orthodoxe Tradition für die deutschen Geistlichen erschwert. Es ist ein Weg in die Wüste, aber gerade dort erkennt man die Schönheit der Werke Gottes, die unter harten Bedingungen zum Blühen kommen.
Das Treffen in Limburg
Dieser entbehrungsreiche Weg einer Pionierorthodoxie zieht Menschen an, die den Wert des orthodoxen Erbes erkannt haben und leben wollen. Genau das ist es, was das Wort „orthodox“ zum Inhalt hat: die rechte Verherrlichung Gottes, wie sie in der ungebrochenen Tradition unsrer Kirche in Liturgie, in der Ikonographie, der Architektur und der Poesie der Hymnen zum Ausdruck kommt. Für diese Lebensformen und das geistliche Amt junge Menschen und Männer zu gewinnen, ist unsre Aufgabe. Unser Treffen im Priesterseminar in Limburg möchte Wege aufzeigen, wie man als Deutscher mit Abitur und Spätberufener mit Familie und beruflicher Bindung dennoch Möglichkeiten hat, sich die Voraussetzungen für das geistliche Amt zu erarbeiten. Unter den Teilnehmern sind etliche, die schon die Hand an den Pflug gelegt haben, um dieses Ziel zu erreichen.
(Erzpriester Johannes R. Nothhaas, freigegeben für öffentliche Verwendung im Januar 2016)
1Es folgten mit der Zeit weitere Gemeinden, wie z.B. in Berlin (Vr. Mihail (Rahr) ) und in München (Vr. Thomas (Diez) ). (Anm. d. Red.)