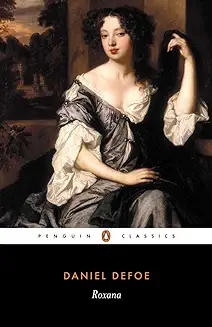
(1724 | 350 S.) Beworben als Geschichte einer Hure oder so ähnlich. Dieses letzte Werk Defoes als Autobiographie einer Frau beginnt deutlich über-moralisiert, und das auch noch in falscher Richtung.
Meinung
Cornelia meint:
Beworben als Geschichte einer Hure oder so ähnlich. Dieses letzte Werk Defoes als Autobiographie einer Frau beginnt deutlich über-moralisiert, und das auch noch in falscher Richtung. Die arme Frau gerät durch ihren blöden Ehemann in äußerste Not, ratscht knapp am Verhungern vorbei, selbst dann noch, nachdem man ihre Kinder hat einigermaßen unterbringen können. Dann erbarmt sich ein reicher Mann: Er argumentiert gut common law marriage -mäßig: ihr Mann ist vermutlich tot, seine eigene Frau ist ihm weggelaufen, was hindert, dass die beiden Verlassenen nun selbst Mann und Frau werden. Das Problem ist: ein solches Zusammenleben ist eine furchtbare Sünde.
Das sieht man zwar ein, der Appell ans Mitleid funktioniert. Allerdings wird dann etwas, was am Ende jeder Priester per Oikonomia als Scheidung gelöst hätte, zu einer puritanisch konzipierten Teufelsfalle. Das treue Dienstmädchen Amy hatte Roxanna zugeraten, sich auf den deal mit dieser rettenden Liebe einzulassen. Aber die Schuldgefühle der Frau, die sich längst als Hure ansieht, lässt diese nicht ruhen, ehe sie – ob aus Rache wegen der Zureden des Mädchens? ob aus dem Wunsch, in der Sünde nicht allein dazustehen? – auch diese mit ihrem Mann zur Hure macht (und auch das dabei entstehende Kind, ebenso wie das, was sie selbst endlich von ihm bekommt, wird dann weggegeben – insgesamt 7 Kinder in fremder Obhut…). Hier wird also eine teuflische Schlinge als gelegt angesehen, die man als nicht-Puritaner nicht ganz einsehen mag.
Dann stirbt der gute Retter, die beiden Frauen sitzen in Paris als reiche Witwe mit Anhang. Ein Prinz überhäuft Roxanna so sehr mit Geschenken und Ehre und Liebe, dass sie zu seiner Mätresse wird. Dabei wird seine eigene Herumhurerei immerhin so weit gebändigt, dass er ca. 8 Jahre lang stabil bleibt, – allerdings weiterhin auf Kosten seiner legitimen Ehefrau, die noch dazu ein Engel und Mutter seiner Kinder ist. Ich habe nicht so große Skrupel, auch diese Beziehung irgendwie nachvollziehbar zu finden (obwohl Roxanna sich, reich wie sie geworden war, durchaus hätte nach England absetzen können. Aber es fehlt dieser Frau halt jede Form von Weltklugheit. Schon in der ersten Armut hätte sie durchaus Gemüse pflanzen können und aktiv Arbeit suchen in der Pfarrgemeinde, die nur auftritt als Verwalterin einer Kinderauffangstation, deren Inanspruchnahme ein barmherziger Onkel vermeiden kann.)
Was mir auch unbegreiflich ist, und bei Defoe überhaupt nicht bedacht wird: warum sie nicht jenen Mann, der sie aus der Armut holte, dazu beknien konnte, ihre Kinder ins Haus mit aufzunehmen, oder doch zumindest das eigene Kind von ihm selbst bei sich zu behalten. War das alles die Sorge wegen Geredes in der Nachbarschaft, wo man sich als ein solches Paar absolut bedeckt halten musste? Vermutlich. Aber als dann der reiche Mann starb, warum war es nicht das Allererste, nach England zu eilen, um die Kinder aus der Armut ihrer Obhüter zu befreien und jene zu belohnen? Natürlich sind Ressourcen endlich, und sie wäre vielleicht wieder im Elend gelandet? Konnte man damals nicht investieren und Zinsen kriegen? Und gab es wirklich keine verlässlich professionelle Hilfe?
Tatsächlich machen die Beschreibungen ihrer Ängste sowohl in Frankreich als auch in England den Eindruck von Gesellschaften, die so wenig durchprofessionalisert waren, dass so eine Frau aufgeschmissen bleiben musste, oder von einer Hand zur nächsten wandern. Aber wenn das alles eine Welt der persönlichen Bindungen gewesen ist, warum hat sie nie gelernt, prophylaktisch ein Netzwerk von Freunden zu pflegen? Von Verwandten, während es ihr noch gut ging?
Defoe beschreibt die Höllenfahrt Roxannas als ziemlich unausweichlich, und das macht ihn zum Verräter an der christlichen Moral, die da überall beschworen wird. Damit gehört auch er zu jenen, die am Ast der europäischen Christlichkeit sägen.
Weiter geht’s: Nach Fallengelassenwerden durch den Prinzen (die brave Ehefrau starb, und das hat ihn zur Besinnung gebracht) weiß sie nicht, wohin mit ihrem angesammelten Reichtum und vertraut sich einem holländischen Kaufmann an. Jener Retter (da spielt noch ein betrügerischer Jude mit, der die Juwelen will und echt gefährlich ist) trifft sie dann in Holland und trägt ihr eine hochanständige Ehe an. Und jetzt kommt ihre gesamte Ehe-Traumatisierung zum Tragen, die auch durch den ersten common law Mann nicht geheilt wurde. Ein Manifest des Feminismus schon hier. Und nur das Geld ist verlässlich. Der Mann liebt echt, sie aber besteht darauf, ihn als Playboy zu halten, als männliche Mätresse. Dazu ist er zu christlich und auch zu anständig, Liebe hin, Liebe her.
Dann wird man mit Geschichten über weitere Mätressereien gelangweilt, bis endlich der casus cnackus das Haupt erhebt: ihre völlige Gleichgültigkeit gegenüber den gesammelten von ihr geborenen Kindern. Immerhin, für die ersten eigenen erwacht dann mal ein Gefühl der Verantwortung. Aber da ihr Ruf in England gründlich ruiniert ist, gerät der letzte Teil des Romans zu einem panischen Versteckspiel mit der einen schlauen Tochter, die schließlich sogar rausgekriegt hat, dass Mama Roxanna ist, also die London-berüchtigte Lebedame. Und Amy, eine Mischung aus Mephistopheles-Beirat bei ihrer lasterhaften Herrin und verführter Unschuld durch jene, die sie zuerst verführte, darstellt, hat sich so sehr die Interessen ihrer Herrin zu eigen gemacht, dass sie am Ende Susan, jene Tochter, umbringt. Was bei Mama trotz aller Nützlichkeit dieses Endes nicht gut ankommt. Ende Gelände.
Der ganze Roman kreist um die Schlinge, die der Teufel um Leute legt, die einmal vom Pfad der Tugend abwichen. Gnadenloser Niedergang. Dabei geht es aber ausschließlich um die Unkeuschheit und den Eigensinn der Freiheitsprophetin (die zugleich völlig unfähig ist, ihr Geld selbst zu verwalten), – das viel wichtigere Problem: was wird aus den Kindern? bleibt ausgeblendet und kommt am Ende nur als Gefahr für die endlich verabredete Ehe mit dem Pariser Retter in den Blick. Das ist zu wenig Substanz, um einen über all die langweiligen Amouren rüberzuretten.
Info
| Erscheinungsjahr | 18. Jh., 1. Hälfte |
| Seiten | 300-600 |
| Autor | Defoe, Daniel |
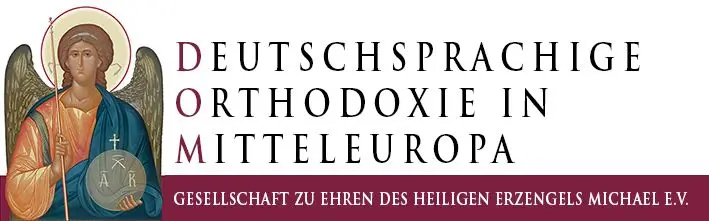
Kommentar zu: Defoe, Daniel – Roxanna.