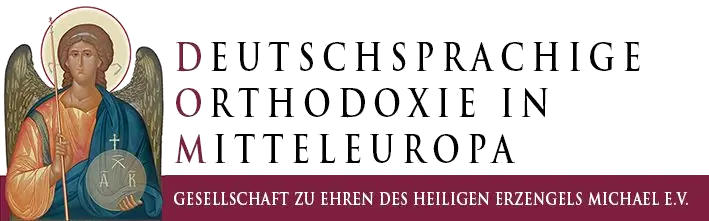Du hast in Demut das Höchste erworben, in Armut den Reichtum. Bitte Christus, unseren Gott, dass Er unsere Seelen errette.
Der heilige Pirmin(us), Bischof von Reichenau
Wir wollen in der Serie „Kurzporträt großer Heiliger“ die Beschützer der deutschen Lande näherbringen – mit den wichtigsten Informationen auf einen Blick, Auszügen aus der Vita zum Vertiefen und Links zum Weiterlesen.

geboren um 690 in Irland od. Narbonne
gestorben 753? im Kloster Hornbach (Rheinland-Pfalz)
Gedenktag am 3. November
Nach der Überlieferung irischer Abstammung, war er Mönch und Glaubensbote. Wohl um das Jahr 720 wurde er in Frankreich zum Bischof geweiht und wirkte im alemannischen Raum am Oberrhein. Er gründete im Jahre 724 auf der Bodensee-Insel Reichenau ein nachmals berühmtes Kloster, dem er als Abtbischof vorstand. Im Jahr 727 wurde er von lokalen Machthabern vertrieben und wirkte von da an als Wanderbischof in Alemannien und im Elsass, wo er eine Reihe weiterer Klöster nach der Regel des hl. Benedikt gründete (Gengenbach, Murbach, Hornbach, Neuwiller u. a.).
Pirmin starb in seinem Kloster in Hornbach. Ende des 8. Jahrhunderts wird er erstmals in einer Handschrift als Heiliger bezeichnet.
Grabinschrift, verfasst vom hl. Hrabanus
Pirminius selbst, Bischof und Christi Bekenner, bewohnt dieses Haus und heiligt den Ort. Um Christi willen hat er die gegenwärtigen Freuden der Welt verschmäht und für sich die Armut erwählt. Er verließ Vaterland, Volk und Verwandte und suchte die Fremde, verdiente den Himmel. Das Volk der Franken hier suchte er mit klarer Lehre zu gewinnen und erbaute für Gott sehr viele heilige Stätten. Hier ruht er nun, hat die Glieder des Leibes abgelegt und mit der Seele besitzt er oben das glückliche Reich. Er hilft allen, die würdig Himmlisches suchen, und in rechter Weise bewahrt er selbst seine Diener.
(Quelle: Wikipedia)

Der Festgesang (Troparion im vierten Ton)
Als Richtschnur des Glaubens und Vorbild der Sanftmut, als Lehrer der Enthaltsamkeit hat die Höchste Wahrheit dich deiner Herde erwiesen.
So hast du in Demut das Höchste erworben, in Armut den Reichtum.
Heiliger Bischof Pirminus, bitte Christus, unseren Gott, unsere Seelen zu retten.
Zeitliche Einordnung
Geografische Einordnung

Nach der Überlieferung irischer Abstammung, wurde er Mönch und Glaubensbote. Wohl um das Jahr 720 wurde er in Frankreich zum Bischof geweiht und wirkte im alemannischen Raum am Oberrhein.
Er gründete im Jahre 724 auf der Bodensee-Insel Reichenau ein nachmals berühmtes Kloster, dem er als Abtbischof vorstand. Zur Klostergründung erhielt als Schenkung die Insel und die Orte Markelfingen, Allensbach, Kaltbrunn, Wollmatingen, Allmansdorf und Ermatingen. Die Abgaben dieser Orte sollten dem neuen Kloster gehören. Die Insel selbst war damals unbewohnt und verwildert. Die Legende erzählt, dass als der Heilige die Insel betrat, Schlangen, Kröten und Gewürm fluchtartig die Insel, auf der sie hausten, verließen und sich in den See stürzten. Drei Tage und drei Nächte soll die Flucht gedauert haben. Danach habe Pirmin mit seinen vierzig Männern die Insel gerodet und urbar gemacht. Für die Mönche unter ihrem Abtbischof Pirmin wurde am Nordufer der Insel ein aus Holz erbautes Kloster mit Kirche errichtet.
Im Jahr 727 wurde er von lokalen Machthabern vertrieben und wirkte von da an als Wanderbischof in Alemannien und im Elsass, wo er eine Reihe weiterer Klöster nach der Regel des hl. Benedikt gründete (Gengenbach, Murbach, Hornbach, Neuwiller u.a.). Er führte diese auch in mehreren elsässischen Klöstern ein, die der Regel des hl. Kolumban gefolgt waren.
Für sein Evangelisierungswerk verfasste er ein Buch mit Aussprüchen, die bis heute erhalten sind. Er entschlief 753 im Kloster Hornbach (Pfalz).
Pirmasens wurde als Waldmark von Pirmins Kloster Hornbach angelegt. Patrozinium der Kirche um 1900, 1954, ein Bischof von Speyer in den Fünfzigern hatte mit dem Bischof von Innsbruck studiert und durch diese persönliche Beziehung erhielten alle damals bestehenden Pirminkirchen im Bistum Reliquien. Reliquien befinden sich in der Jesuitenkirche von Innsbruck, im Dom zu Speyer, in Hornbach, in Pirmasens und in der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde in Ludwigshafen.
Zu den Persönlichkeiten, die wesentlich zur Verbreitung des Christentums auf dem Gebiet der Alemannen beitrugen, gehört der heilige Pirmin. Seine Herkunft ist ungewiss, vermutlich kam er aus Aquitanien und floh vor den Angriffen der Sarazenen in das fränkische Königreich. Dort wurde er um 720 zum Bischof für die Stadt Meaux bei Paris geweiht, wo er nicht nur auf Latein, sondern auch auf Fränkisch predigte. Auf Anregung des fränkischen Hausmeiers Karl Martell, der als Nachfolger Pippins das Frankenreich kirchlich zu re-organisieren suchte, wurde Pirmin als Missionar ins Gebiet der Alemannen, in den Westen des damaligen fränkischen Reichs und an den Oberrhein geschickt. Obwohl er etwa zur gleichen Zeit wie Bonifatius im Gebiet des heutigen Deutschlands das Evangelium verkündete, sind sich die beiden Heiligen nie begegnet.
Auf Einladung des (von Karl hierzu aufgeforderten) alemannischen Adligen Sintlatz kam Pirmin mit seinen ca. 40 Begleitern um 724 auf dessen ‘bis dahin unbewohnte‘ Bodensee-Insel Reichenau. Eine Legende besagt, dass alle Schlangen, Frösche und anderen wilden Tiere die Insel fluchtartig verließen, als der Heilige dort eintraf. Die Mönche rodeten die Insel und machten sie urbar, erbauten eine der Gottesgebärerin und den Aposteln Petrus und Paulus geweihte Kirche und gründeten das Kloster Mittelzell. Wirtschaftliche Grundlage wurden die dem Kloster geschenkten Abgaben der Orte Markelfingen, Allensbach, Kaltbrunn, Wollmatingen, Allmansdorf und Ermatingen. Karls Absicht, neue Bistümer einzurichten, Klöster als Ausbildungszentren für Priester zu unterstützen, die letzten heidnischen Praktiken auszurotten und die kirchlichen Institutionen eng an den fränkischen Staat zu binden, erfüllte sich zumindest langfristig: Dieses Kloster, dem Pirmin als Abtbischof vorstand, wurde neben St. Gallen zu einem der bedeutendsten geistlichen Zentren im Karolingerreich.
Einige Forscher behaupten, dass Pirmin in Rom selbst zum Bischof geweiht wurde und die Zustimmung und den Segen des Papstes erhielt, bevor er in das oben genannte Gebiet entsandt wurde. Auf Einladung des alemannischen Adligen Sintlatz kam Pirmin um 724 auf der Insel Reichenau an, wo er eine Kirche erbaute und später das Kloster Mittelzell gründete. Die Kirche war der Muttergottes und den Heiligen Peter und Paul geweiht. Die Insel war zuvor unbewohnt. Eine Legende besagt, dass alle Schlangen, Frösche und andere wilde Tiere die Insel verließen, als der Heilige dort eintraf. Das von Pirmin erbaute Kloster auf der Insel Reichenau wurde neben dem Kloster St. Gallen zu einem der bedeutendsten im Karolingerreich.
726 jedoch sah sich der Heilige Pirmin durch den alemannischen Herzog Theobald (der den fränkischen Einfluss in seinem Gebiet nicht schätzte) von der Insel vertrieben. Hinfort wirkte er als Wanderbischof in Alemannien und im Elsass. Dort gründete er weitere Klöster, z. B. Gengenbach, Murbach, Weißenburg, Maursmünster und Neuweiler, in denen er die vormals kolumbanische Regel durch jene des Heiligen Benedikt ersetzte. Von einem weiteren Kloster Hornbach aus gründete er in dessen Waldmark die Stadt Pirmasens.
Pirmin starb am 3. November 753 im Kloster Hornbach. Seine wichtigsten Reliquien liegen heute, abgesehen von den alten Pirminkirchen im Bistum Speyer, in Innsbruck.
Pirmin und das apostolische Glaubensbekenntnis
Während in der Orthodoxen Kirche das Glaubensbekenntnis, wie es auf den Konzilien in Nicäa und Konstantinopel formuliert wurde, als Bekenntnisformel Verwendung findet, ist in der westlichen Kirche das Apostolische Glaubensbekenntnis verbreitet. In der Überlieferung wird es auf das Apostelkonzil in Jerusalem zurückgeführt, schriftlich fixiert ist es in Latein, zuerst bei Rufinus von Aquilea (4. Jh.), endgültig dann beim hl. Pirmin. Vermutlich er verfasste „De singulis libris canonicis scarapsus“ („Auszug aus den einzigartigen kanonischen Büchern“), wo auch dieses Credo enthalten ist:
Das apostolische Glaubensbekenntnis
Petrus:
Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Johannes
Und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn.
Jakobus sagte:
Dieser ist vom Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau Maria geboren worden.
Andreas sagte:
Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben.
Philippus sagte:
Er ist hinabgestiegen in die Unterwelt.
Thomas sagte:
Am dritten Tag erstand er von den Toten.
Bartholomäus sagte:
Er ist zum Himmel aufgestiegen und setzte sich zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Matthäus sagte:
Von dort wird er kommen, die Lebenden und Toten zu richten.
Jakobus, der Sohn des Alfeus, sagte:
Ich glaube an den Heiligen Geist.
Simon der Zelote sagte:
Und die heilige katholische Kirche.
Judas, der Sohn des Jakobus, sagte:
An die Gemeinschaft des / der Heiligen und die Vergebung der Sünden.
Ebenso sagte Thomas [er redete zum zweiten Mal]:
An die Wiederauferstehung des Fleisches und das ewige Leben.
Zitiert nach: Heiligenlexikon.de

(Foto: Joachim Specht – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0,Wikipedia)

Auszug aus der Reliquien-Liste von Cornelia Hayes:
| Gemeinde | Gebäude | Stelle | Geschichte der Reliquien | Zugang |
| Annweiler am Trifels | St. Pirmin | Hornbacher Eigenkirche | ||
| Bern | im späten Mittelalter kamen kleine Reliquien nach der Reichenau und von dort nach Bern | |||
| Eppenbrunn | St. Pirmin in 66957 Eppenbrunn. Weiherstr. 5 | Kreuzförmige Monstranz mit Reliquie, und Monstranz mit Relique | 1847 Patrozinium, eine Reliquie kam aus einem Pirmin-Internat in Dahn und eines mit Fingerknochen+D776 | 06335 423 |
| Friesenheim | Kloster | gründete wohl ein Ire Offo. Erstes Kloster auf der rechten Rheinseite | ||
| Gengenbach | Kloster | gründete es | ||
| Glan-Münchweiler | St. Pirmin | Hornbacher eingenkirche | ||
| Hornbach | Benediktinerabtei-Ruine | Es gibt hinter der ev. Pfarrkirche im Klosterbezirk, das man nur über das Hotel betreten kann, eine Grabkapelle über dem ehemaligen Grab. | so wenig ist auch über den Verbleib seiner Gebeine bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden sie bis zum Jahre 1575 in der Klosterkirche Hornbach verehrt. Im selben Jahr gelangten sie (worauf Klaus Weger mich aufmerksam machte) wegen der Reformation durch den damaligen Statthalter von Tirol, den Grafen Schweikkard von Helfenstein, und dessen Gemahlin Maria von Hohenzollern in die Jesuitenkirche Innsbruck. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Gebeine noch vollständig, mit Ausnahme einer Fingerreliquie, die im 14. Jahrhundert als Schenkung an das Kloster Reichenau gelangte. ich habe dann noch einen Satz gefunden:Erst am 2. Juni 1891 erhielt die Pirminiuskirche in Hornbach eine Reliquie, und zwar, die siebente und neunte Rippe des Heiligen. Und ich weiß nicht, welche Kirche das sein soll. Etwa die evangelische Pirminskirche??? | über das Hotel |
| Hornbach | St. Pirmin von 1930, Kirche Bitscher Straße 5 | in einer Wand ein kleiner Reliquienbehälter | Patrozinium 1930, Bei einem Bombenangriff auf Innsbruck wurde der Schrein unter einer einstürzenden Mauer begraben. Von den aus dem Schutt geborgenen Reliquien gelangten einige an die Diözese Speyer, die sie am 21. Juli 1953 in Anwesenheit des damaligen Bischofs Dr. Emanuel in die Pfarrkirche Hornbach übertrug. | |
| Innsbruck | Jesuitenkirche | Seitenaltar der Jesuiten-Kirche St. Pirmin. | Die Reliquien wurden aus Hornbach (siehe dort) nach Innsbruck übertragen, offenbar an die Jesuitenkirche. Die Jesuiten vermachten im 16. Jahrhundert weitere Reliquien an verschiedene Klöster im Deutschen Reich. Bei einem Bombenangriff auf Innsbruck am 15. Dezember 1943 wurde das Glas des Pirminschreines zerstört. Nach seiner Wiederherstellung wurde er in die Kirche St. Jakob übertragen, die jedoch nur ein Jahr später selber einem Bombenangriff zum Opfer fiel. Der Schrein wurde dabei unter einer einstürzenden Mauer begraben. | Sonntag nach dem 3. November |
| Landau in der Pfalz | St. Pirmin | Hornbacher eingenkirche | ||
| Marmoutier | Neugründung des Benedikt von aniane Klosters | |||
| Murbach | Kloster | |||
| Obernheim-Kirchen-arnbach | St. Pirmin | Patrozinium 1971 | ||
| Pirmasens | St. Pirmin, 66953 Pirmasens, Klosterstr. 7 | links von der Haupt Apsis an der Mauer ein große Schädelrelique hinter einem vegetabilartigen Gitter | Pirmasens wurde als Waldmark von Pirmins Kloster Hornbach angelegt. Patrozinium der Kirche um 1900, 1954, ein Bischof von Speyer in den Fünfzigern hatte mit dem Bischof von Innsbruck studiert und durch diese persönliche Beziehung erhielten alle damals bestehenden Pirminkirchen im Bistum Reliquien | über die Schwestern des Nardini Hauses, 06331-7220 vor 12 oder nach 13 Uhr fragen |
| Reichenau | Schatzkammer des Münsters | im Schrein mit Felix | Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden Pirmins Gebeine bis zum Jahre 1575 in der Klosterkirche Hornbach verehrt. Im selben Jahr gelangten sie durch den damaligen Statthalter von Tirol, dem Grafen Schweikkard von Helfenstein, und dessen Gemahlin Maria von Hohenzollern in die Jesuitenkirche Innsbruck. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Gebeine noch vollständig, mit Ausnahme einer Fingerreliquie, die im 14. Jahrhundert als Schenkung an das Kloster Reichenau gelangte. | |
| Rheinmünster | Kloster | |||
| Sankt Ingbert | St Michael, von der Layen STr. 72 | Da die Pirminskirche in eine Kita umgewandelt wird, ist die Reliquie in die Verantwortung von St. Michael gerlangt, | Pfarramt 06894 4275, die Pfarrsekretärin bringt nach Genehmigung des Pfarrers die Reliquie in die Kirche | |
| Speyer | Dom | Obere Taufkapelle oder Katharinenkapelle | 1953 eine Rippe und ein Stück der Schädeldecke wurden aus Innsbruck zurück-überführt, Münsterschwarzach schuf 2000 einen neuen Schrein | |
| Speyer | Dom | Kreuz von Hupp 1904 gefertigt, über dem altar der Katharinenkapelle | ||
| St. Paul im Lavanttal | Stiftskirche | 1777 wurde eine Reliquie aus Innsbruck von Maria Theresia an St. Blasien imSchwarzwald gegeben, die sich heute in St. Paul befindet | ||
| Walsheim | St. Pirmin | 1853 Patrozinium | ||
| Zweibrücken | St. Pirmin | 1966 Patrozinium |
Zum weiterlesen
Die heilige Lioba auf Orthpedia (Quelle)
Der heilige Pirmin auf Heiligenlexikon.de
Literatur:
- Hans Ammerich: Hl. Pirminius (= Das Bistum Speyer und seine Geschichte. Bd. 5). Sadifa Media, Kehl am Rhein 2002, ISBN 3-88786-183-3.
- Arnold Angenendt: Monachi Peregrini. Studien zu Pirmin und den monastischen Vorstellungen des frühen Mittelalters (= Münstersche Mittelalter-Schriften. Bd. 6). Fink, München 1972, ISBN 3-7705-0605-7 (Zugleich: Münster, Universität, Dissertation, 1969).
- Arnold Angenendt: Pirmin. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, ISBN 3-428-00201-6, S. 477 f. (Digitalisat).
- Richard Antoni: Leben und Taten des Bischofs Pirmin. Die karolingische Vita (= Reichenauer Texte und Bilder. Bd. 9). 2., erweiterte Auflage. Mattes, Heidelberg 2005, ISBN 3-930978-82-2.
- Adriaan Breukelaar: PIRMIN (Permin(i)us, Primenus). In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 7, Bautz, Herzberg 1994, ISBN 3-88309-048-4, Sp. 634–637. (Artikel/Artikelanfang im Internet-Archive)
- Ursmar Engelmann: Pirminius: Mönch, Bischof und Missionar. In: Benediktinische Monatschrift. Bd. 29, 1953, ISSN 0930-4924, S. 452–459.
- Michael Görringer: Pirminius. Geschichte des linken Rheinufers, vorzüglich der bayerischen Pfalz, von den ältesten Zeiten bis auf Karl den Großen; besonders die Einführung und allmählige Verbreitung des Christenthums in diesem Gebiete. Wahrburg, Zweibrücken 1841, Digitalisat.
- Clemens Jöckle: Das große Heiligenlexikon. Sonderausgabe. Parkland, Köln 2003, ISBN 3-89340-045-1, S. 374 f.
- Wilhelm Wiegand: Pirmin von Reichenau. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 26, Duncker & Humblot, Leipzig 1888, S. 179.