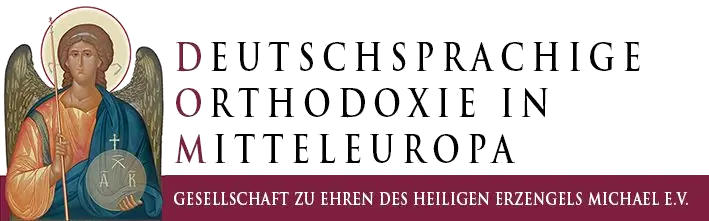Jahreskalender der Heiligen auf der DOM-Synaxis Ikone
Willibrord, Apostel der Friesen 658-739, 7. November

Willibrord kommt, wie so viele Missionare auf dem Kontinent, aus England. Sein Vater war Soldat. Im Alter zog er sich in die Einsamkeit zurück, starb als Einsiedler und wird unter dem Namen Wilgis als Heiliger verehrt.
Der Sohn erhielt in Northumbria eine hervorragende Ausbildung in den Klöstern Ripon und Mellifont, wo er auch zum Priester geweiht wurde. Von seinem Abt Egbert zusammen mit 11 Schülern (unter ihnen auch der Heilige Suitbert und die beiden Heiligen Ewalde) zu den kurz zuvor durch Pippin den Mittleren eroberten Friesen ausgesandt, leistete er eine bemerkenswerte Missionsarbeit. Die Friesen wohnten damals noch nicht in Städten und kannten auch keinen Getreideanbau Sie lebten von der Jagd und vom Fischfang. Sein Lehrer der hl. Bischof Wilfrid hatte hier bereits im Jahre 617, unter dem König Algis, mit Erfolg gearbeitet. Aber um das Jahr 692, als der hl. Willibrord hier ankam, sahen die Friesen das Christentum nur noch als ein Mittel politischer Unterwerfung unter den fränkischen König und lehnten es deshalb hartnäckig ab. Erst nach militärischen Erfolgen des fränkischen Hausmeiers Pippin Heristal über neuen friesischen König Radbod, in dessen Folge große Teile Frieslands dem fränkischen Reich einverleibt wurden, machte die Missionierung notgedrungen Fortschritte. Dazu wurde allen, die das Christentum annahmen, große Vergünstigungen gewährt.
Anders als die früheren irischen Wandermönche verstand Willibrord seine Angewiesenheit auf Zusammenarbeit mit den örtlichen Mächten. So begab er sich auch auf Wunsch Pippins im Jahre 695 zu Papst Sergius I. nach Rom und wurde von diesem am 22. November desselben Jahres zum Bischof mit dem Namen Clemens geweiht, und mit dem Pallium geehrt. Nach 14 Tagen kehrte er bereits wieder nach Friesland zurück.
Hier residierte er im heutigen Utrecht, gründete mit Hilfe des neu bekehrten Adels eine Missionsschule, erbaute eine Kathedralkirche zu Ehren des Erlösers, und eine Kirche zu Ehren des hl. lebenspendenden Kreuzes, die er später dem hl. Martin weihte. Außerdem begann er dort ein Kloster, in welchem nicht nur seine aus England mitgebrachten Mitarbeiter lebten, sondern bald auch Schüler aus den umliegenden Völkern. Im Auftrag von Pipin Heristall missionierte er auch an Maas und Mosel. Um das Jahr 695 gründete er das Kloster Echternach, das sich als Markt zu einem wichtigen Handelszentrum entwickelte. Seine Mönche legten Moore und Sümpfe trocken und führten Acker- und Weinbau ein.
In Köln erhob der Heilige die Reliquien der hl. Cunera. Bis nach Antwerpen hin mühte er sich um die Überwindung alter heidnischer Bräuche wie Felsen-, Quellen- und Baumverehrung. Durch die Unterstützung der fränkischen Großen errichtete er viele Kirchen und Versammlungsräume für die Einheimischen, die von seinen Schülern verwaltet wurden. Unter anderem geht auch die Marienkirche zu den Märtyrern und die Paulskirche in Trier auf den hl. Willibrord zurück, ebenso die Münsterkirche von Emmerich. Im Kloster Oeren in Trier wehrten die Nonnen die Pest mit vom hl. Willibrord geweihtem Wasser ab. In Hyloo entstand auf die Gebete des Heiligen ein Brunnen, der bis auf unsere Tage dort besteht. Im Jahre 711 gründete er mit der Unterstützung der Herzogin Plectrudis das Kloster Süstern
Nach einer erfolglosen Missionsreise zum dänischen König Ongentheow wurde er durch einen Sturm nach Helgoland verschlagen, wo er drei Männer taufte. Dabei nutzte er eine Quelle, aus welcher nach heidnischem Brauch nur schweigend Wasser geschöpft werden durfte. So zog er sich erneuten Hass König Radbods zu, welcher ihn nur mit Rücksicht auf den mächtigen Pipin am Leben lies. Auf der Insel Walchern stürzte er eine Götzenstatue um. Der Wächter, welcher den hl. Willibrordus daraufhin verwundete, wurde augenblicklich vom Teufel besessen und starb am dritten Tag. Dieses Zeichen hatte eine so große Wirkung auf Radbod und sein Volk, dass der Heilige daraufhin für einige Zeit auch in den vom Frankenreich noch unabhängigen Gebieten missionieren durfte.
Seit 714 aber, als Folge der Ermordung von Grimoald brach ein neuer Krieg zwischen Franken und Friesen aus. Seit dieser Zeit blieb Echternach alleiniger Stützpunkt für Missionsreisen, die bis nach Thüringen reichten. In einem von Herzog Hedan II. übertragenen Schloß zu Hammelburg richtete Willibrord ein Kloster ein.
Erst im Jahre 717 musste König Radbod kapitulieren. Die zerstörten Kirchen wurden wieder aufgebaut. Drei Jahre half ihm dabei der Priestermönch Bonifatius, bevor dieser sich wieder der Missionierung Mittelgermaniens zuwandte. Im Jahre 726 schrieb Bischof Willibrord sein Testament, in welchem er alle ihm geschenkten Güter dem Kloster von Echternach übertrug, wo er auch beigesetzt zu werden wünschte. Das Testament beginnt: “Im Namen Christi. Es ist notwendig, dass die Christen stets den Weg der Wahrheit kennen, auf welchem sie ihrem Schöpfer auf würdige Weise durch ihre Verdienste zu gefallen vermögen, damit das Werk ihrer Almosen und ihre Frömmigkeit ihnen zur Seligkeit gereichen. “ Ganz ähnlich sagt der hl. Seraphim von Sarow 1000 Jahre später, nur diejenigen guten Werke erwerben uns den Heiligen Geist, welche wir ausdrücklich um Christi willen tun.
Er wurde in der Klosterkirche zu Echternach begraben. Gleich nach seinem Tod wurde er wie ein Lebender um seine Fürbitte bei Gott in verschiedenen Anliegen, mit Erfolg, angerufen, besonders erfolgreich gegen die Pest und den Veitstanz. Als ihm Jahre 1031 [275] der Abt Humbert seine sterblichen Überreste aufdeckte fand man dieselben noch fast vollständig erhalten. Die Kutte und die Umgürtung, Cilicium genannt, und der seidene Mantel in welchem er 300 Jahre vorher begraben worden war, waren noch gut erhalten. Reliquien von ihm ruhen in Echternach
Links
https://orthpedia.de/index.php/Willibrord
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienW/Willibrord_von_Echternach.html
Quellen: Wiki, Oekumenisches Heiligenlexikon, Orthpedia, Mönch Melitons Heiligenviten, Vladyka Hiobs Kurzfassungen, Vater Alexandrus beiden Bände, der Tagungsband der russischen Konferenz in Berlin, einige Monographien.