
(um 1855 | 453 S.)
Meinung
Cornelia meint:
Geständnisse 1854
Über den Atheismus der deutschen Philosophen und ihren Fanatismus, der nicht einmal Voltaire’s Deismus mehr ertragen will. Heine fand es okay, diesem Atheismus zu frönen, solange die Sache auf die gesellschaftliche Elite beschränkt und dem Personal verborgen geblieben war. Sobald sich aber der Pöbel dieses Atheismus bemächtigte, verging Heine der Appetit daran, und zudem sorgte er sich um die dadurch beförderte Stärkung des Kommunismus. Denn Mitleid mit den Schwachen ist gut und schön, aber wehe, wenn sowas an die Macht gelangt! Über Hegel und Meyerbeer. Hegel appellierte an die Eitelkeit des jungen Heine, der sich freute, an Stelle Gottes im Himmel selbst zum Gott erklärt worden zu sein – was diesen allerdings eine Weile lang zu höchster Tugend und Barmherzigkeit anstiftete. Aber das ganze Theater wurde endlich doch zu teuer und zu anstrengend. Die Repräsentationskosten! So dankte er ab und ließ es sich mit bequemem Theismus wohl sein: soll Gott doch machen, Der kann das eh besser. Da hole ich mir dann auch Trost für meine Wehwehchen.
(Man sieht hier den ganzen Hohn, mit dem Heine seinen eigenen Glauben auseinandernimmt.)
Seit seinem Buch über Deutschland hat er seine Ansichten über Gott gründlich geändert. Er sieht Marx, Feuerbach und Konsorten als would be Selbstgötter und gibt zu, dass der Deismus doch weiterhin am Leben ist und bleibt.
Moses als Erfinder Gottes? Heine hat sich der Bibel als poetischem Schatz wieder zugewandt, er freut sich der religiösen Gefühle und braucht dazu keine Kirche. Er bleibt nur evangelisch, damit er in Preußen legal einreisen kann. Er schätzte früher das aufgeklärte Christentum ohne Gott, jetzt aber, voll frommer Gefühle und Leiden, hat ihm doch der Protestantismus was zu bieten und die Reformation als Ursprung der deutschen Philosophie. Verdienst der Juden, durch Bewahrung der Schrift der ganzen Welt das Reich der religiösen Philosophie vererbt zu haben. Und außerdem Reinheit, Sittlichkeit, Nächstenliebe. In all dem sieht er das Wiedererwachen der Sittlichkeit des alten Judentums.
Juden, Jesus und die Römer zum Thema Eigentum.
Rolle der Jesuiten zwischen Scholastik und Aufklärung: obwohl sie die Menschen zu Kindern machen wollten, ging der pädagogische Eros mit ihnen durch und sie besorgten die Aufklärung.
Hist für 19. Jh Religionen
Ludwig Marcus 1844
Sein Verein für Kultur und Wissenschaft des Judentums, die er auf der ganzen Welt verbreiten wollte. Die Regierungen sollten den Juden dankbar für die Aufrechterhaltung des Deismus sein, denn wenn der mal weg ist, gibt es nur noch Mord und Totschlag.
Die Juden sind erst dann emanzipiert, wenn sie auch die Emanzipation der Christen erkämpft haben. (Oh weh!)
Hist Rel +
Bd 7
Ludwig Börne
Ein ungemein rätselhaftes Buch. Es beschreibt die anfängliche Faszination durch diesen klugen, begabten und idealistischen Mann, dann die eintretende Distanzierung, die Börne selbst offenbar niemals bemerkte (oder bemerken wollte), so dass der endgültige Bruch mit Börne von jenem als Verrat gedeutet und öffentlich zur Verurteilung von Heines Charakter führte. Auch haben Freunde wie Feinde Börnes stets auf dessen Verhältnis zu Heine Bezug genommen, und da will er einfach mal Klarheit schaffen über alle beide.
Er beschreibt Börne als einen „nazarenischen“ Geist (also einen asketischen, bilderfeindlichen, vergeistigungssüchtigen Geist des Judentums wie des Christentums, im Unterschied zum lebensstolzen, entfaltungsheiteren, realistischen hellenischen Geist, dem Heine neben Goethe sich selbst zurechnet) mit Märtyrer-orientiertem Republikanismus. Sehr eindrucksvoll finde ich, wie Heine seine eigenen Gemütsverfassung und politische Einstellung in verschiedenen Phasen seines Lebens beschreibt, um, wie er sagt, dem Leser zu erlauben, sein Urteil über Börne auch als subjektiv durch die jeweilige Lage des Urteilenden bedingt seinerseits beurteilen zu können. Da ist edel. Interessant die Bemerkungen über Hegels Darstellung des Judentums (nicht als Religion des Wortes sondern des Geistes). Christi Kreuzestod sieht er als wichtige Station bei der Vergeistung des Abendlandes, die er als Krankheit sieht, wo Heilung nur von Goethe und Napoleon zu erhoffen ist. Gegen die AT Geschichte mit Dina setzt er seine Sittlichkeit des reinen Menschengefühls, das positive Religion und Staat überdauern wird. Im NT liest er die letzten Worte Christi (ich hab euch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht begreifen) als Versprechen eines Millenniums auf Erden. Die Bibel als Wort Gottes – wie Shakespeare. Und die poetische Partei Goethes. Denn das hellenisch gesunde Heidentum ist in der Dichtung immer untergründig lebendig geblieben (wie wahr für Goethe!)
Dann über die gemeinsame Zeit des Exils in Paris. Wachsender Verfolgungswahn Börnes. Börne als Literat und Politiker. Über Charakter und Stil. Und um von daher Börnes Wesen besonders eindrucksvoll darzustellen, zitiert Heine, man muss schon sagen: ober-cool – einen längeren Verriss aus dessen Feder über Heines Charakter. Diese hanebüchenen Anschuldigungen, die er zum Teil durchaus nachvollziehbar aufzählt, werden in keinster Weise widerlegt. Da vertraut Heine dem Leser sich rückhaltslos an.
Das Ganze endet mit der Sorge, dass die Republik die Poesie töten wird, denn die Poesie muss mit dem König gehen.
Ein Fundus an interessanten Gedanken. Und ein schönes Zeugnis für Heines (von seinen Gegnern bös verschandelten) Humanität.
Hist
Über Polen
Anlässlich einer Reise nach Posen
Unbedingt lohnend diese originellen und politisch lebendigen Beobachtungen
Jg
Verschiedenartige Geschichtsauffassung
Interessant über Historiographie.
Hist
Die Februarrevolution 1848
Schön kompakt
Hist Jg
Memoiren 1854-5
Interessant darin über Grabbe
Erbrecht bei Juden und Römern
Das ganze ist als Kindheitsgeschichte höchst unterhaltsam
Jg
Info
| Erscheinungsjahr | 19. Jh., 2. Hälfte |
| Seiten | 300-600 |
| Autor | Heine, Heinrich |
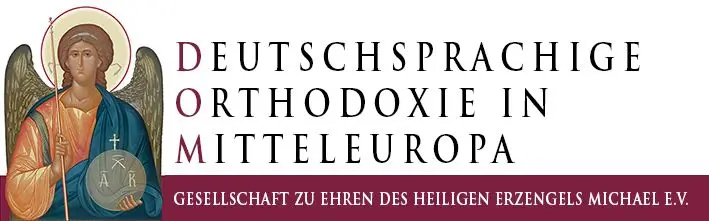
Kommentar zu: Heine, Heinrich – Geständnisse/ Ludwig Marcus/ Ludwig Börne u. a..