Matthias Gilberts Philosophie, Glaube und Intuition (Aachen 2020) möchte angesichts der fast absoluten Irreligiosität der Gegenwart („Das Profane ist das Normale“) aufzeigen, wie sehr auch das Denken des modernen Menschen (unreflektiert) auf Gott bezogen bleibt.
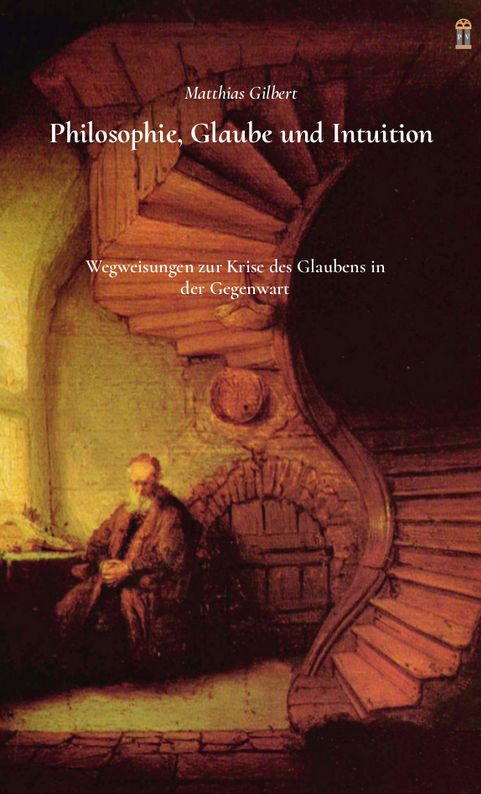
Philosophie, Glaube und Intuition
Verlag Patrimonium, Aachen 2020, 14,80 €
Der russische Religionsphilosoph Wladimir Solowjew hielt Ende des 19. Jahrhunderts in einer Vorlesung über das Gottmenschentum fest: »Ich werde über die Wahrheiten der positiven Religion sprechen – über Dinge, die dem modernen Bewusstsein, den Interessen der modernen Zivilisation sehr fern und fremd sind.« Diese Krise des Glaubens, die schon Solowjew benennt, mithin das Unverständnis, das die zeitgenössische Zivilisation der Religion gegenüber an den Tag legt, hält nicht nur weiter an, sie hat sich fraglos noch verschärft und verschärft sich beständig weiter: Der Geist der Irreligiösität ist mittlerweile zu einem fast allgemeinen Phänomen geworden – das Profane ist das Normale!
Matthias Gilbert begibt sich auf eine Spurensuche nach den Ursachen dieser Entwicklung, davon ausgehend, dass Religion eben keine Privatmarotte ist, wie man heutzutage häufig hört, sondern ein großes, ja das größte Geschenk, das ein Mensch erhalten kann.
Cornelia hat das Buch für euch gelesen und eine Rezension für DOM verfasst.
Für orthodoxe Leser bemerkenswert an dieser Abhandlung eines der römischen Konfession zugehörigen jungen Theologen ist die Ähnlichkeit seines Vorgehens mit dem orthodoxer Autoren, wie etwa von H.T. Engelhardt in After God oder von Rod Dreher in Benedict Option. Seine Zeit-Diagnose über die „religiöse Krise“ setzt bei Wladimir Solowjews Vorlesung über das Gottmenschentum an, er rezipiert neben patristischen auch neuere orthodoxe Quellen, und in vielen Hinsichten sieht er die Dinge wie wir. Dies betrifft zum Beispiel seine Ablehnung von „Gottesbeweisen“ wie auch seine Unterscheidung des modernen Fortschrittsglaubens von der Traditions-gegründeten Wahrnehmung kulturellen Niedergangs (S. 49), des Darwinismus von der Vision eines ursprünglichen Paradieses (S. 59) und der bloß psychischen von der geistlichen Erkenntnis (S. 85). Dies betrifft auch seine Betonung des „traditionalen Menschen“, seine Wahrnehmung des familiären Haushalts als Tempel (S.74, wir würden mit dem Heiligen Johannes Chrysostomos „kleine Kirche“ sagen), seine Ablehnung einer Trennung von Heiligem und Profanem wie auch der platonischen Annahme einer Priorität der Ideen vor dem Schöpfungsakt (S. 93), seine Kritik am evolutionären Paradigma und seine Überzeugung, dass es ohne Transzendenz keine menschliche Verantwortlichkeit, Personalität und Freiheit gibt (Kap. 21). Ähnlich wie übrigens schon der protestantische Theologe Matthias Claudius (1740-1815) gegen die Aufklärer, so appelliert auch Gilbert (mit Blaise Pascal) an eine dem Menschen eingeborene Ahnung seiner göttlichen Berufung und bejaht ein theozentrisches Weltbild (S. 77). Er deutet die historische Tatsache religiöser Verankerung aller bisherigen Kulturen als starkes Argument für die Sachhaltigkeit einer solchen Ahnung und schließt von da auf die Willkürlichkeit der neuzeitlichen Abwertung religiöser Weltsichten. Von daher folgert er, dass die religiösen Menschen eigene Offenheit für Tranzendenz-bezogene Erfahrungen nicht von vorneherein als irrational abgetan werden kann.
Bis hierher können orthodoxe Leser Gilbert mit Vergnügen folgen. Besonders in den späteren Kapiteln aber entfernt er sich von der Tradition. Beim Versuch, sein Argument gegen die heutige Abwehr „des Religiösen“ außerhalb einer spezifisch christlichen Apologetik anzusiedeln, nimmt er ein recht unpräzises, religionswissenschaftlich verallgemeinertes Gottesbild in Kauf. Wie immer ein solcher Ansatz auch von vielen russischen Theologen des 19. Jahrhunderts vertreten worden sein mag, macht es einen Unterschied, ob man (wie Solowjew und andere) auf der Grundlage eines erfahrenen kirchlichen Lebens auf akademische Nachbargebiete ausgreift, um zu einem Dialog mit nicht-Orthodoxen einzuladen, oder ob man diese Methode „von außerhalb“ eines solchen Lebens einsetzt. Für orthodoxe Christen im Westen ist es wichtig, die Verankerung ihrer eigenen theologischen Diskurse (gerade auch mit nicht-Orthodoxen) in jenem kirchlichen Leben stets im Blick zu halten. Darum mag es für uns hilfreich sein, die Risiken zu bedenken, die mit einem rein religionswissenschaftlichen Vorgehen (wenn auch in römischer Prägung) einhergehen: Bereits der Ansatz beim Tatbestand von „Religion“ trifft eine Vorentscheidung gegen den für Christen gebotenen Ansatz bei „Kirche“. So werden Warnsignale „auf stumm geschaltet“, die hätten helfen können, eine Kompromittierung genuin christlicher Ziele zu vermeiden.
- Ein erster Schritt zu solcher Kompromittierung geschieht bereits im 6. Kapitel. Hier wird das „Religiöse“ einem „Primat des Seins“ zugeordnet und dieses dem säkularen Primat des (materiellen) Werdens gegenübergestellt. Solch metaphysischer (S. 87 ff) Zugriff auf „Religiöses“ birgt die Gefahr, dass man die Personhaftigkeit (überdies dreifache Personalität) Gottes und überhaupt Seine uns Menschen als geradezu eifernd, ja eifersüchtig geoffenbarte Liebe vernachlässigt. Ohne eine primäre Fokussierung auf diese Personalität ist es (auch wenn Gilbert dies möchte) schwer, die aristotelische Fiktion eines „unbewegten Bewegers“ abzuwehren (vgl. S. 98, wo der Logos als unwandelbar Geistiges erscheint).
- Auch die Redeweise vom Logos als Vernunft (S. 99) und von einer im Logos erschaffenen Welt, die an der Geisteswelt Anteil habe und von daher ihre göttliche Bestimmung als metaphysischen Traum erlebt, wird dem sehr viel stärker personalen „in Ihm leben wir“ (Apg. 17:28) bei Paulus nicht gerecht.
- Ebenfalls zu platonisch erscheint insgesamt Gilberts einseitige Festlegung der „Leidenschaften“ auf den „materiellen“ Teil des Menschen (S. 59f) und eines geistlichen Lebens auf die „Beherrschung des unterworfenen Körpers.“ Der erste Schritt beim Sündenfall war nicht die Lust auf den Apfel, sondern der von der Schlange geweckte Ehrgeiz, „ohne Gott“ zu sein „wie Gott“ und um Gut und Böse zu wissen. Die Fleischlichkeit, die Paulus der Sünde zuordnet, umfasst körperliche und geistige Sünden.
- Dieses Verhaftetbleiben an westlicher (hier: platonischer) Philosophie lässt Gilbert den „höchsten und reinsten“ Ausdruck der – wie wir sagen würden – Gottähnlichkeit des Menschen auf den Intellekt (S. 81) festlegen. Damit entfernt er sich von seiner anfänglichen und in Kap. 18 bekräftigten Betonung der Zentralität des menschlichen Willens. Es sollte doch, wie der Autor richtig betont, gerade dieser (sittliche) Wille sein, der sich entscheidet: entweder für die Beschränkung auf rein innerweltliche Erfahrungen oder für die Suche nach Gott und das Bemühen um Transzendenz-bezogene Erfahrungen!
- Nun entspricht in der Tat dem Intellekt (im Unterschied zur ratio) selbst noch bei Thomas von Aquin das, was die griechischen Quellen als Nous bezeichnen, als „Organ“ für Transzendenz-bezogene Erfahrungen. Aber Gilbert erläutert diese noetische Erfahrung ausgerechnet im Rückgriff auf den islamischen, vom Sufismus inspirierten Philosophen Hossein Nasr. Damit behindert er eine angemessene Wahrnehmung des entscheidenden Unterschieds zwischen christlicher und muslimischer Lehre: Während die kirchlich vermittelte noetische Erfahrung das Gnadengeschenk eines Gottes ist, der im personalen Miteinander den von Ihm hierfür geschaffenen Menschen in seiner spezifischen Personalität zur Fülle seiner göttlichen Berufung erhebt, lässt die islamische (wie auch die asiatische) Mystik alle personalen Unterschiede in der Vereinigung mit einem „neutralen Göttlichen“ spurlos verschwinden. Kurz gesagt geht der Unterschied zwischen noetischem und nicht-noetischem Wissen nicht im Unterschied zwischen intuitivem und diskursivem Wissen auf, sondern bezieht den Unterschied zwischen synergetisch auf Gott antwortendem und autonom gewonnenem Wissen ein.
- Ein weiterer (vom orthodoxen Standpunkt aus gesehen) Nachteil dieser Verhaftetheit an die metaphysische Ausrichtung römischer Theologie tritt in Kapitel 8 zutage. Bei der Diskussion darüber, was Gott rationaler Weise „tun kann“ und „nicht tun kann,“ wird Gott in einer Weise vergegenständlicht, die auf orthodoxe Christen befremdlich wirkt. Diese Befremdlichkeit betrifft zunächst überhaupt den Anspruch, über Gottes „Können“ irgendetwas aussagen zu wollen. Gilbert folgt hier seinen westlichen Quellen, wenn er die Haupt-Verantwortung (S. 174 „das entscheidende Ereignis“) für den Verfall des Christentums in der Ersetzung des (platonisch-aristotelischen) Ideen-Realismus durch den Ideen-Nominalismus (eines Duns Scotus oder Wilhelm von Ockham) sieht. Die von Gilbert bejahte Alternative zwischen dem an Rationales gebundenen Gott des Realismus und einem irrationalen Gott des Nominalismus (wie im Islam, vgl. S. 95) ist nicht erschöpfend: Wie beim Gegensatz zwischen Gilberts Sein und Werden, so gehen auch hier orthodoxe Christen von einer dritten Alternative aus: Weil sie sich kirchlich verstehen, stehen sie in der Tradition noetischer Erfahrung göttlicher Offenbarungen Seines Willens. Sie legen darum das noetische Wissen nicht fälschlicherweise auf Geometrie, Mathematik, logische Gesetze und kategoriale Grundbegriffe fest (S. 86 ff) oder auf die Schau des Wesens der Dinge (S. 83 f). Vielmehr bewahrt sie die Tradition dieser Erfahrung vor dem von Gilbert angenommenen bloßen „Fiduzialglauben“. Orthodoxe Christen können Gottes Willen mithin als primär anerkennen, ohne „Irrationalitäten“ befürchten zu müssen, – ja, ihr ganzes intellektuelles Training beruht überhaupt auf der Kreuzigung des (stets weltlich infizierten) Intellekts. Anders als die philosophischen und theologischen Nominalisten des Abendlandes kann die Kirche sich darum unbeschwert am „Herr, lehre mich Deine Ordnungen“ ausrichten.
- Diese Befremdlichkeit eines vergegenständlichenden Redens „über“ Gott betrifft andererseits die dabei vom Redenden eingenommene Haltung. Für orthodoxe Christen geschieht solches Reden immer zugleich als „im Angesicht Gottes“. Schon unter Menschen gilt es ja als unhöflich, in Gegenwart des einen „über ihn“ zu einem dritten gleichsam nur Sach-bezogen zu reden, so als wäre jener gar nicht anwesend, oder als wäre sein Dabeisein unerheblich. Schon hier versuchen wir, durch Einbeziehung, oder doch zumindest durch Blickkontakt, seiner Anwesenheit Rechnung zu tragen. Wie viel mehr sollte unser theologischer Diskurs den Rahmen einer Haltung anbetender Zugewandtheit – oder doch wenigstens einer wahrgenommenen und unser Reden richtenden Gegenwart Gottes – nicht überschreiten.
- Gewiss gesteht Gilbert zu, dass Gott als personaler Schöpfer nicht vom Gott „als metaphysischer Ort der Ideen“ trennbar sei. Aber seine Wiedergabe kirchenväterlicher Aussagen trägt wiederum zu wenig der Tatsache Rechnung, dass der Logos in erster Linie Person ist. Stattdessen bejaht Gilbert eine analogia entis (S. 111), die der apophatischen Tradition der Kirche nicht gerecht wird.
- Weiterhin verführt ihn seine Verhaftet heit an westliche Philosophie dazu, das alte Argument einer Angewiesenheit menschlicher Gesellschaften auf religiöse Verankerung von Moral vorzubringen. Wir Orthodoxe halten solche Appelle für ineffizient. Wie das Beispiel des späten John Rawls zeigt, hat einer der führenden säkularen Ethiker unserer Zeit letztlich den Anspruch rationaler Begründbarkeit aufgegeben und die Geltung seiner Theorie der Gerechtigkeit auf einen bloßen (und somit kontingenten) modus vivendi reduziert. Eine solche bloß konventionelle Vereinbarung unter demokratischen Mehrheiten aber bedarf keiner religiösen Absicherung. Sie bedarf nicht einmal jener religiösen Motivationsquellen und Bilder, die der späte Habermas, ein anderer führender Ethiker unserer Zeit, als unverzichtbar ansieht.
- Schließlich ist dieses selbe Verhaftetbleiben auch dafür verantwortlich, dass Gilbert vom noetischen Erkennen spricht als fähig, sich „bis zur Gottesschau hinaufzuschwingen“ (S. 83) und vom Gläubigen als einem „Pontifex ins Jenseits.“ Solche Redeweise sind für orthodoxe Christen nicht akzeptabel: Bei aller Betonung des menschlichen Willens zur Erlangung seines Heils bleiben sie sich doch ihrer Angewiesenheit auf die von Gott her ausgestreckte Gnaden-„Hand“ dankbar und bittend bewusst.
Diese Beispiele mögen genügen um festzustellen: Es ist nicht ratsam, beim Bemühen um eine Wiederbelebung christlichen Lebens die ungeteilte, und damit authentische Kirche, als die Grundlage dieses Lebens, außer Acht zu lassen. Schon das Bemühen um den Anschein philosophischer Objektivität in der Hoffnung auf somit erweiterte öffentliche Akzeptanz ist riskant: Man gerät in Versuchung, beim zutiefst ambivalenten, zwar göttlich inspirierten, aber auch dämonisch infizierten Phänomen „des Religiösen“ anzusetzen. Um aber das Ansetzen bei der Kirche möglich zu machen, muss man sich auf die Erfahrung ihres Lebens einlassen. Es ist dem so vielversprechenden jungen Autor zu wünschen, dass er hierzu die richtige Wahl trifft.
