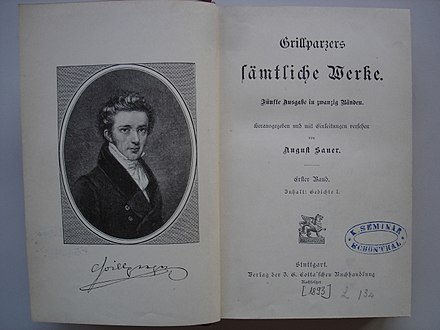
(1819 | 211 S.)
Meinung
Cornelia meint:
Der Gastfreund
Phryxus, aus dysfunktionaler Familie, findet keinen Platz mehr zuhause und kriegt in Delphi im Traum ein Orakel, das ihn dazu bringt, einem dort aufbewahrten Gott das Goldene Vlies zu rauben – und wohl noch einen ziemlichen Haufen an Tempelschätzen dazu. Aber man lässt ihn ziehen, respektiert also die Realität der götterlichen Zustimmung. Damit fährt er nun nach Kolchis, wo er als Gastfreund Unterschlupf finden möchte, weil er sonst nicht recht weiß, wohin, und weil der dort verehrte Gott genau das geraubte Vlies als Standbild um die Schultern trägt. Da fühlt der Junge sich göttlich beschützt.
Ortsfürst Aietes hingegen wittert reiche Beute, und zum Ethos des Gastrechts ist er als nicht-Hellene und Barbar noch nicht vorgedrungen. Seine Tochter Medea ist auch schlecht erzogen, macht, was sie will, hat nur Kopf für die Jagd und die Klicke ihrer Jungfrauen, die geschworen haben, nie einem Mann anzuhängen. Was bei einer schiefgegangen ist, und die kriegt von Medea die ganze Verachtung der moralischen Überjungfrau um die Ohren.
Inzwischen erbittet Papa ihren Rat im Umgang mit den Fremden, aber sie mault und muffelt, verhindert allerdings, dass Phrxrus den ihm „gastlich“ gereichten Todestrank trinkt. Sie selbst hält nämlich das Gastrecht heilig und respektiert auch den Hausgott, der Heimtücke nicht mag.
Nun, den Phryxus erwischt es trotz dessen blinden Vertrauens auf eben jenen Hausgott, in dessen Namen er aber kurz vor dem Hinscheiden zur Warnung an die Mordbuben noch gründlich Flüche verteilt. Dem Aietes ist das egal, er verteilt den Goldschatz an seine treuen Kolcher zum Verjubeln, versteckt aber das goldene Vlies sicher in einer Drachen-geschützten Höhle. Und ab da ist jener Hausgott dann nicht mehr nötig und gehört gleichsam in die Rumpelkammer.
Die Argonauten
Immerhin, Medea hat den Fluch ernst genommen, ist in einer Turmruine am frühen Altern, weil das alles ihre Zauberkünste außer Kraft gesetzt hat, an denen sie mühsam rumhäkelt in ihrem Grauen. Inzwischen hat sich die Sache mit Phryxus in Griechenland herumgesprochen und Jason hat eine Schar zusammengekriegt, die rächen und das Vlies zurückholen wollen. D.h. er will das, die Jungs folgen ihm ahnungslos und blind begeistert.
Auch hier wird zunächst brav und treu auf Gastfreundschaft vertraut, aber Jason wie Milo riechen den Braten, denn wiederum denkt Aietes nur ans Umbringen und Ausrauben. Der Bruder Medeas, Absyrtus, hätte den in den Turm tollkühn eingedrungenen Jason fast umgebracht, hätte Medea ihn nicht abgehalten. Der ist nämlich in der Begegnung mit Jason was passiert, was sie nicht einordnen kann, und der Rest des Dramas widmet sich der peinsamen Entwicklung von stolzer Jungfrau zum liebenden Eheweib. Jason macht das echt gut, zwischen Überredungs-Süßigkeit, schroffem Befehlston und kalter Zurückweisung der ihn Zurückweisenden. Das Ganze vollzieht sich im Wald, wo immer einer den anderen am beinah Abschlachten ist. Aber auch hier verhindert Medea, dass Jason den Trank, den sie bereiten musste, auch wirklich trinkt. Sie hat ihm somit schon zweimal das Leben gerettet, bleibt aber äußerlich stur und steinern. Nun, endlich schafft es Jason, bei ihrer Flucht mit Bruder im Wald sie abzupassen, und irgendwann landet sie an seiner Heldenbrust.
Kaum ist das abgehandelt, geht Jason zum business über: er hat ja sein Wort gegeben, das Vlies zurückzuholen, – wobei unklar bleibt, wer das unbedingt braucht und wozu. Vielleicht einfach, um Gerechtigkeit herzustellen: Der Aites soll den Raub nicht behalten. Nun ein neuer Streit, denn Medea ist überzeugt, dass der Drache in der Höhle Jason töten wird: mal wollen sie beide sterben, mal nur einer den anderen töten und tut es dann doch nicht, – jedenfalls entfaltet Jason die ganze Autorität des Ehemanns. Da ist also Medea grad beim nächsten Typen gelandet, der partout nicht auf sie hören will. Jason meint nämlich, dass es Sachen gibt, die ein Mann halt machen muss, und in diesem Weltbild hat eine klügere und wissendere Frau nichts zu suchen. Immerhin, Jason schafft es tatsächlich, mit Hilfe von Medeas Zaubermittel das Vlies rauszuholen und das Mädel mit zum Schiff zu bringen. Aberaber irgendwie haben Drachenkampf und Zaubermittel seinen Seelenfrieden gestört: Innerlich angekränkelt ist er nicht mehr recht er selbst. Jetzt muss Medea ihm hinterhersorgen.
Bruder Absyrtus kommt, die vermeintlich Gefangene zu retten. Ihre Liebe zum Bruder bringt sie zu Tränen, sie soll heimkommen, – und bei alledem wird er von Jasons Leuten als Geisel geschnappt, damit Aites das Schiff sie nicht verfolgt. Da er diesen Verlust seiner Freiheit nicht erträgt, stürzt Absyrtus sich ins Meer. One down für den Fluch. Papa Aites kann ab jetzt jahrelang den Verlust beider Kinder beklagen, lebendig beerdigt, sozusagen. Two down. Allen ist zudem klar, dass die Heimreise kein Vergnügen wird und das erhoffte Eheglück ist auch schon eher nicht mehr wahrscheinlich. Wir erwarten resigniert den Leichenschmaus des dritten Teils.
Medea
Zwar auch hier gewaltige Längen, aber Stoff und Behandlung faszinieren. Jason, der sich zu Ende des zweiten Teils schon ziemlich merkwürdig verhielt (man konnte das auf Störung durch Drachen zurückführen) enthüllt jetzt die ganze Erbärmlichkeit seines Machotums. An Medea hatte ihn bloß deren Widerstand gereizt, das musste er besiegen – und dann passten die zwei halt doch nicht zueinander, und dies immer weniger während der jahrelangen Irrfahrten auf wilder See. Gora, die mitgeschleppte Amme, erzieht inzwischen die zwei frisch geborenen Buben mit anti-hellenischen Vorurteilen. Medea ist als Mutter so lieblos, dass die Kinder sich nach ihrer Landung in Griechenland gleich der Sandkastenfreundin Jasons, der Königstochter Kreusa, an den Hals werfen und zu Mami überhaupt nicht zurückwollen.
Der Argonauten-Mannschaft war die Reise insgesamt schlecht bekommen: der Fluch des Vlieses brachte sie allesamt um. Jasons Onkel, dem er das Ding liefern sollte, gibt trotzdem nicht das Erbe raus. Wird krank. Jason suggeriert, ob Medea nicht einen „Heiltrank“ hat? Diese, vom Mitleid für Onkels Töchter bewegt, zaubert tatsächlich einen. Onkelchen schläft sich gesund, aber kaum schnappt Medea (warum bloß?) sich das Vlies, wacht er auf und wird vom Gespenst des von ihm ermordeten Bruders (Jasons Vater) so gequält, dass er nun doch stirbt. Medea, von vorneherein als barbarische Migrantin unwillkommen und misstrauisch beäugt, wird jetzt des Mordes beschuldigt. Die Familie muss vor dem Volkszorn fliehen. Keine Rede mehr vom Erbe. Bei König Kreon suchen sie Schutz, Tochter Kreusa soll, letzte Chance, aus Medea eine brave Griechin machen. Die hat inzwischen Vlies und Zauberkram verbuddelt und will auch neu anfangen.
Aber mit dem Leierspielen wird das nix, besonders, da Kreusa ihr ausgerechnet eines der Sandkastenlieder von früher beibringt, von dem sie weiß, wie sehr es Jason freuen wird. Leider weckt dieses Lied in Jason Jugenderinnerungen und Sehnsucht nach der netten Kreusa, die man schon damals mochte. Medea kocht und sagt die Nachhilfestunden ab. Im Tempel spricht ein Orakel gegen sie und Jason. König Kreon kann nur ihn retten, und das nur als seinen Schwiegersohn. Und – ohne die Kinder. Man verhandelt, die Kinder dürfen bleiben, nur Medea soll weg. Angesichts dieser Zumutung wächst bei Medea der barbarische Rachedurst (unbedingt nachvollziehbar, angesichts der Schäbigkeit Jasons, der die Ehe mit ihr als Jugenddummheit verkauft). Sie buddelt ihren Zauberkram wieder aus, verbrennt den Palast samt Kreusa und ermordet die Kinder.
Am Schluss treffen sich beide Eheleute als Verbannte in der Einsamkeit. Jason jammert rum, Medea empfiehlt das Dulden und besteht darauf, weiterhin seine Frau zu sein, aber jeder wird für sich alleine Hungers sterben.
Natürlich wird der Götterkram subtil psychologisiert – vermutlich so, wie das Christentum in Grillparzers Lebenswelt. Man hält die Riten schon noch in Ehren, macht ansonsten, was man will, und schiebt den Göttern in die Schuhe, wenn was schiefgeht. Die hatten ja vielleicht doch ihre Händchen im Spiel. Das Ganze ist zwar zäh und lang, aber unbedingt faszinierend, und ich kann mir wirklich gute Gespräche mit Jugendlichen darüber vorstellen. Immerhin kann man an dieser 19. Jh Rekonstruktion der alten Griechen sehen, wie erlösend das Christentum gewesen sein muss, und an der Analogie zum 19. Jh Christentum, wie nötig die Orthodoxie für Westeuropa wäre.
Man müsste halt auch die Originale dazulesen.
Info
| Erscheinungsjahr | 19. Jh., 1. Hälfte |
| Seiten | 100-300 |
| Autor | Grillparzer, Franz |
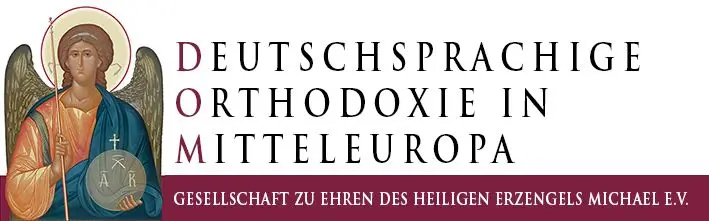
Kommentar zu: Grillparzer, Franz – Trilogie des Goldenen Vlieses.