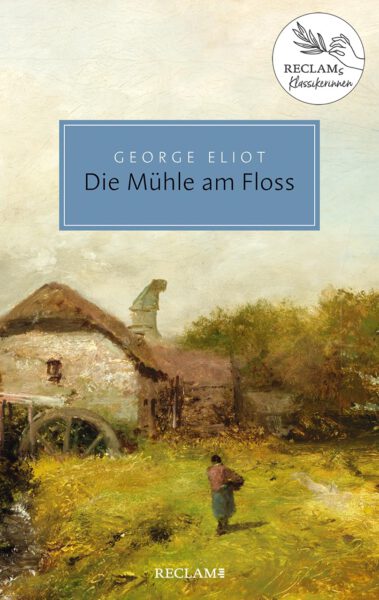
(160 | 550 S.)
Meinung
Cornelia meint:
Hauptperson ist ein allzu pfiffiges, wissbegieriges, liebebedürftiges, naturbürschiges Mädchen, das zwischen einer bürgerlich verblödeten Mutter und einem selbstgerecht lieblosen Bruder unverstanden bleibt. Zwar hat sie beim Vater einen Rückhalt, aber die gesammelte Tanten- Schar bringt so viel Gift ins Haus, dass das liebe Kind sich angesichts der braven Base Lucy in eine eifersüchtige Medusa verwandelt und nicht nur sich selbst die stets unzähmbaren Haare abschneidet, sondern auch Lucy in den Matsch wirft, alsdann zu den Zigeunern ausreißt. Das geht alles noch irgendwie gut, aber diese toxische Umgebung lässt Fürchterliches erwarten.
Eliot ist ein Genie der komprimierten Welterfassung. In drei Sätzen hat sie ganze Dramen bloßgelegt, die das Leben der Provinzgesellschaft vergiften. Es gibt da viel zu lachen und zu bewundern, denn ihr moralischer und psychologischer Feinsinn ist beeindruckend. Einerseits also bietet das kleine Mädchen eine Projektionsfläche für alle anderen unverstandenen kindlichen Genies (und das kindliche Genie in uns allen), andererseits stößt sie uns per analogiam mit der Nase auf unsere eigenen eigennützigen Selbsttäuschungen. Wer sich da durcharbeitet hat viel Gewinn.
Die nächsten Bücher handeln vom Schul-Alltag und vom Ruin der Tulliverschen Mühle mit allen Begleitumständen eines säkularen Gerichts durch Tanten und angeheiratete Onkel. Graus, Graus obergraus, und nur der Lausbub-Freund Bob aus Toms Kinderzeiten kommt und bietet Geld zur Hilfe aus völlig uneigennütziger Dankbarkeit für ein vor Jahren geschenktes Messer. Dieser Tunichtgut ist der einzige Mensch für die beiden jungen Leute.
Aber hat es tatsächlich bis S. 318 gedauert, bis ich mir klarmachte, dass da nirgends Gott vorkommt? Natürlich gibt es überall Pfarrer und Pfarreien und Hinweise auf die schädlichen Katholiken. Aber alle diese Menschen sind völlig Gott-verlassen, und ich habe es vor lauter prächtiger Unterhaltung nichtmal gemerkt. Immerhin, zu Beginn von Buch IV, Valley of Humiliation, nachdem zu Ende von Buch III Tulliver den Sohn Tom gezwungen hat, den Fluch gegen Rechtsanwalt Wakem, dem er sein Scheitern anlastet, in die Familienbibel zu schreiben, zusammen mit seinem erklärten Nicht-Verzeihen und der Verpflichtung Toms, bei Gelegenheit Rache zu nehmen, – nun, da gibt es eine Abhandlung über einen Protestantismus, von dem Bossuet nichts wusste. Und diese Darstellung eines christlichen Heidentums ist aufschlussreich, denn hier haben wir, was Christen gerne als die goldene Zeit intakter Kirchlichkeit und jetzt vorbei beweinen (mal abgesehen davon, dass es die falsche Kirche ist) aufs abscheulichste kritisch demontiert. Abscheulich im Vergleich zu dem, was sein sollte, – aber dabei auch immer liebevoll den irregeführten Menschen gegenüber, die in den langsamen und schmerzlich erkauften Fortschritt der Menschheit eingebunden sind. Oh weh, und wie wahr ist Eliots Diagnose für die tiefsitzenden Bürgerlichkeit in uns allen!
Aber der eigentliche Wendepunkt ist das dritte Kapitel, in dem die seelisch verhungernde Maggie die Nachfolge Christi von Thomas a Kempis als Rettungsanker ergreift. Und hier wird es für uns Orthodoxe interessant, denn dieses Buch steht uns nahe und wird auch von den unsrigen rezipiert. Aber die Hinwendung zu Gott, die seine Lektüre bei Eliots Maggie auslöst, besteht aus knallharter Entsagung, aus einem inneren Selbstmord in die Abtötung hinein, die durch keinerlei göttliche Antwort gestützt wird. Und so findet Maggie, anders als unsere Asketen, in der Selbst-Entäußerung keinen Zugang zur göttlichen Liebe und Freude, die auf ihre Familie hätte erlösend wirken können. Stattdessen kann Philip, der ihre Spaziergänge verfolgt und eine geheime Beziehung anknüpft, mit seiner Liebe die Todesfahlheit dieser Selbstvernichtung ihr zum Vorwurf machen. Langsam lässt sie sich durch diese Liebe auf die einzig erkennbare Alternative locken: das Mitleid mit diesem leiblichen Krüppel und seelischen Helden in eine Liebe verwandeln zu lassen. Hier also ist der Weg zur Liebe geöffnet, aber er geht über ein Mitleid, das ihr – als sie sich später in der Begegnung mit Stephen, Lucys Verehrer, zuallererst selbst kennenlernt als Frau – kein Gegengewicht bieten kann.
Sicherlich hätte aus dieser Mitleidsbeziehung eine gute Ehe werden können, aber dagegen standen große Hindernisse: die geheimen Treffen werden in der Gesellschaft bekannt und gefährden das Einzige, was den Verarmten noch geblieben ist: die Ehre. Tom greift darum rücksichtslos durch. Er hat kein Herz und keine Seele, nur die Tugend als Verteidiger der Familienehre und Treue zum Vater. Da bleibt für das Leiden der kleinen Schwester kein Platz. Und er macht völlig klar, dass Toms reicher Vater, mit dessen Hilfe Papa Turner ruiniert wurde, niemals eine solche Ehe erlauben wird. Das wichtigste Hindernis aber, und das zeigt sich erst später, als Maggie nach Jahren der Arbeit „in Stellung“ auf Besuch zu Lucy kommt, und als Stephen sie mit seiner Leidenschaft einfach mitreißt, liegt in Philips leidender Selbstbezogenheit. Die beiden haben ihre Beziehung wieder angeknüpft, Papa Wakem ist mit der Heirat einverstanden – aber Bruder Tom droht ihr, dass sie ihn verlieren wird, weil ihm das Gedächtnis des Vaters, der verstarb, nachdem der Wakem durchprügelte, kostbarer ist als das Wohl der Schwester. Und im Intervall, das diesem Hindernis geschuldet ist, zwängt sich Stephen immer tiefer in ihr Herz. Den beiden widerfährt eine Bootsfahrt die von der Gesellschaft als gemeinsames Durchbrennen, Verrat an der lieben Lucy und Verlust der Familienehre gedeutet wird. Maggie kämpft sich frei, bewahrt ihre Tugend, und hat den Nerv, nach Hause zurückzukehren, wo Tom sie nicht ins Haus lässt.
Dort geht sie durch die Hölle der öffentlichen Verurteilung – und erfährt, dass die Kultur der clanship, die sie immer nur als vergiftend und bedrückend kennengelernt hat, eine Kehrseite hat: Aunt Glegg, das Ungeheuer in Person, läuft groß auf und verteidigt die Nichte, da deren Schuld nicht bewiesen ist. Großartig dieser Blick in das Gerüst dieser Provinzwelt: einerseits einer Gesellschaft, die eisern ihre mores verteidigt, auf denen sie beruht (und deren Verlust wir heute bedauern, ohne an die Kosten für den Einzelnen zu denken), andererseits eben die Familie, die versklavt und auch wieder rettet. Trotzdem wird Maggie immer verzweifelter, und kein Gott ist da, der auf ihre Gebete antwortet. Der Himmel schwarz und schweigend. Und in dieser Situation versagt Philip. Statt über seinen Schatten zu springen und an ihre Not zu denken, von der er doch wusste, dass er sie in das Verlobungsversprechen gedrängt hatte, und die doch treu bleiben wollte, und hinzugehen und nach ihr zu gucken, pflegt er – immer „weiblicher“ in seine Gefühle verstrickt – seine eigenen Befindlichkeiten. Der wäre also eh nix gewesen.
Und dann kommt die „Erlösung“ vom grausamen Fatum. Der Fluss tritt bei Nacht über die Ufer, Maggie rettet noch Bobs Familie, bei der sie untergekommen war (und die in ihrer Armut und Unschönheit und zweifelhaften Rechtlichkeit doch – ebenso wie die verarmte Tante Gritty – ein Hort der aufopfernden Nächstenliebe ist und, anders als Grittys hoffnungslose Zukunft, durch Bobs Unternehmergeist geschäftlich aufsteigen wird. Dann rudert sie zur Mühle, rettet Tom, der sie plötzlich als Schwester erkennt und anerkennt, bevor beide untergehen und am Ende gemeinsam begraben bleiben.
Das ganze also ziemlich ganz fürchterlich, trotz vieler Liebenswürdigkeiten und Schönheiten. Aber ganz Gott-verlassen. Und als solches lehrreich für uns.
Info
| Erscheinungsjahr | 19. Jh., 2. Hälfte |
| Seiten | 300-600 |
| Autor | Eliot, George |

Kommentar zu: Eliot, George – Die Mühle am Floss.