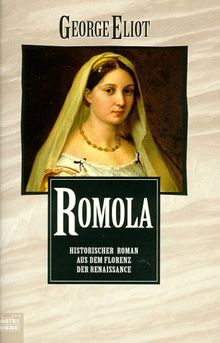
(1863 | 660 S.)
Meinung
Cornelia meint:
Ein lohnendes Buch. Schwer zugänglich, weil durchaus vollgestopft mit allem, was es über das Florenz der Renaissance zu wissen gibt, insofern historisch interessant. Was mich aber begeistert ist die Darstellung eines jungen Griechen, Tito Melemes: ein bezaubernder Mensch, voller Einfühlung und Warmherzigkeit, gewinnend, klug – und mit nur einem Fehler: er hat es nicht gern ungemütlich. Seine Menschenfreundlichkeit ist eine Funktion seiner Bequemlichkeit, und angesichts der Herausforderung, seinen Adoptivvater aus der vermuteten Sklaverei zu suchen und mit dem Erlös seiner Tito anvertrauten Juwelen auszukaufen entscheidet er sich stattdessen für seine gerade beginnende Karriere in Florenz und für die Ehe mit dem geliebten Mädchen. Und lässt sich nebenher mit einem Landmädchen ein, einfach weil es zu schwierig ist, sie loszuwerden. Und aus diesen kleinen Schwächen und Versäumnissen wächst eine gewaltige Nemesis aus Angst und Abwehr, die sein Lebensglück zerstört und das des endlich doch aus eigener Kraft befreiten und rächend auftauchenden Vaters und seiner eigenen Frau gleich mit. Hier wird sonnenklar, wie das substantiell Böse aus winzigen Bequemlichkeits-Entscheidungen herauswachsen kann.
Das zweite Großartige ist, wie Romola die Ehe ohne Liebe nicht mehr aushält und fliehen will, sich als Wissenschaftlerin in Venedig etablieren. Savonarola hält sie an und bezwingt ihren Eigensinn durch die Erinnerung an ihre Pflicht dem Mann und der Stadt gegenüber. Sie lässt sich von der geistigen Kraft dieses Mönchs umstimmen und widmet ihr Leben den Kranken und Armen. Sie müht sich um Anschluss an die Kirche, mit der sie, von einem Liebhaber der Antike erzogen, nichts anfangen kann. Gar nichts. Trotzdem gibt sie sich Mühe und kommt zu allen Predigten Savonarolas. Politische Wirren zerstören gegen Ende jedoch dessen Nimbus als von Gott mit Visionen und Prophetie versorgt. Er muss Kompromisse schließen und lässt Romola ratlos und Führer-los zurück. Eine Flucht mit Suizid-chance lässt sie einer Pest-kranken Dorfgemeinde zur Retterin werden, das gibt ihr neue Kraft, um ihren Dienst in Florenz fortzusetzen. Erschütternd ist, wie hier die Christlichkeit zur bloßen Aufopferung gerinnt. Da ist kein Platz für Freude und Liebe, sondern nur ein unablässiges Selbst-Opfer. Als orthodoxer Christ kann man sich das gar nicht vorstellen: dieses Elend. Dabei ist sie doch vorbildlich auch durch die eigene Reue hindurchgegangen und versorgt am Ende, nach dem Tod Titos, auch noch dessen uneheliche Frau samt Sohn. Obwohl sie den Glauben an Savonarola verloren hat, bleibt sie seiner Botschaft treu.
Also eher Heldentum als Synergie mit Gott.
Erschütternd als Nebenthema: in welchem Ausmaß auch hier wieder eine junge Frau von ihrem Vater instrumentalisiert wird. Ja, er ist blind, und sie das Licht seines Alters. Aber er kommt nie auf die Idee, dass ein junger Mensch halt auch mal Freunde braucht. So wächst sie in der Enge dieser Fürsorge bereits heran, vollkommen ausgerichtet auf Glauben und Dienst an seine wissenschaftlichen Ambitionen (die allesamt nichts taugen). Die Liebe zur Antike ist hier zum bloßen Konservatismus geronnen und trägt zur lebendigen Gegenwart nichts mehr bei.
Hist, Jg +
Info
| Erscheinungsjahr | 19. Jh., 2. Hälfte |
| Seiten | > 600 |
| Autor | Eliot, George |
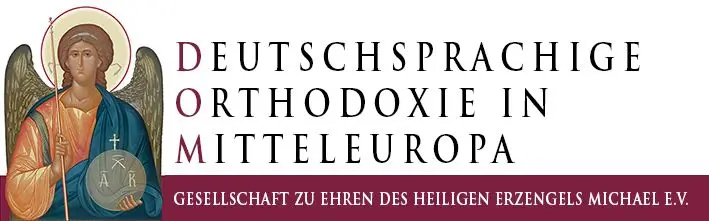
Kommentar zu: Eliot, George – Romola.