
(1864 | 400S.)
Meinung
5 Bücher in zwei Bänden
Cornelia meint:
Bd 1
Es beginnt lyrisch, später merkt man die „tiefere Bedeutung“: Mondromantik gegen Aufklärung/Bürgerfleiß. Ausgeführt am Gegensatz Professor Felix vs. Doktor Fritz: Professor sucht lateinische Handschrift von Tacitus, Fritz macht in indogermanische Sprachen und Mythen. Rationalismus in der Geschichtsschreibung als Fortschrittserzählung vs. Volkssagen als Inspiration aus der Frühzeit. Allerdings ist es im ersten Fall die historische Persönlichkeit bedeutender Männer, die auf die Gegenwart „befruchtend“ wirken soll, während bei Fritz die schaffende Volkskraft im Mittelpunkt steht, – dabei wirft Professor ihm Verweichlichung durch disziplinloses Rumsammeln vor. Dann wird das ganze „downstairs“ gespiegelt in Mentalität und Feindschaft konkurrierender Hutfrabrikanten, und hier wird Freytag wieder rettungslos trivial, wenn auch ziemlich amusant.
Im Schloss, wo die Handschrift versteckt liegen soll, erschließt sich den angereisten Akademikern ein eigenes, gut regiertes Reich der Landwirtschaft. Der Besitzer erfährt die Schatzsuche in den alten Mauern als de-stabilisierend für deren Haltbarkeit, und das Geraune im Volk als Aberglauben. Professor verliebt sich in Großbauerntochter Ilse, die der Doktor eher wie mythische Raunerin anschwärmt. Von Heirat rät er ab. Wie soll denn diese Herrin ihres Reiches sich in eine brave Professorengattin mausern? Und sucht – Marke Grimm und Arnim – nach Volksliedern und Sagen (wobei er den 12-jährigen Haus-Sohn ohne Wissen der Großen gleich mit-infiziert – und ihn so auch dem Rest seiner kirchlichen Prägung entfremdet….).
Da ist viel Gedankentiefes über historische Studien drin, ich sehe Anklänge an andere Schatzsuchen (Ringparabel: „Grabt nur Kinder, grabt“), über das Licht, das die Wissenschaft ins Volk trägt, das seit Jahrhunderten fast nur tierhaft existiert hat, aber doch eigenes Ethos entwickelte, das wiederum den Gelehrten imponiert. Über die kirchliche Tradition ist man raus, sei es durch Überführung in eine Vernunftreligion, der die arme Ilse immerhin was Edles zuerkennen will (obwohl Professors freies Denken sie mit Recht beunruhigt), sei es durch weitherziges Geltenlassen heidnischer Vielfalt. Oder sei es im Blick auf das moralische oder im Blick auf (letztlich) ein ästhetisches Elitenverständnis. Da wachsen also schon die „Werte“, die hier allesamt noch auf das „Volk“ (die Ersatz-Kirche) hin schön gebündelt erscheinen. Eine protestantische Alternative zum katholischen Max Scheler, der die Werte auch schon heraus-operiert hat, sie aber gut thomistisch in eine Hierarchie ordnet, mit dem Heiligen als Sahnehäubchen obendrauf. Letzteres geht im ersten Weltkrieg kaputt, ersteres im Nationalsozialismus. Die Liebe zum Volk (eigentlich auch ein Gebot der Frömmigkeit) wurde um der völkischen Reinheit willen zur Ausmerzung „Volksfremder“, und man muss den heutigen Anti-Diskriminierern zugeben, dass solches Ausmerzen auch in der Kirche als „Abschneidung von Häresien“ vorkommt. Vor diesem (völkischen) Hintergrund kann man deren Kirchen-Feindlichkeit beinah verstehen. Dagegen müssen wir als Christen die geistige Unterscheidung, früher auf die Ausrottung von Häresien fokussiert, heute auf den Anti-Ökumenismus, in spezifisch Christus-liebende Formen gießen, und hier beeindrucken mich besonders die frühen Vertreter des letzteren in der französischen Emigration, und dann in Amerika, also Zander, Schmemann, Afanasiew und solche Leute.
Ilse wird also Professorengattin und findet dank ihres liebevollen Gemüts schnell Freunde im Konflikt über die Veröffentlichung einer Fälschung durch einen Kollegen, was von Felix korrigiert wird. Überall wirkt diese Idealgestalt zum Guten. Nerven kann, wie sehr hier mal wieder ein Frauenbild entworfen wird, das aus lauter Entsagung besteht und ganz auf die Oberlehrerträume des gelehrten Mannes zugeschnitten wurde. Denn ihre Hingabe ist grenzenlos. Großartig aber, dass sie, indem sie sich in seine Geisteswelt einführen lässt, präzise merkt, wo seine Bejahung einer Volksgemeinschaft und sogar Einheit des Menschengeschlechts als einziger Deutungshorizont für gelingendes Leben den persönlichen Behüte-Gott ihrer Kindheit ausschließt. „Ich sehe nur …eine tiefe Kluft, welche meine Gedanken von deinen Scheidet. O nimm mir die Angst, welche mich jetzt um deine Seele peinigt.“ Und: „Was kann ich dir sein, dem der einzelne so wenig und klein ist“. Für das erste hat Felix nur die „vielen Wohnungen“ in Christi Haus anzubieten, fürs zweite die Beteuerung, dass er in ihr das gesamte Menschengeschlecht liebt. Hm naja. Kein Wunder, dass Ilse, die ein Liebes-Ideal der vollkommenen geistigen Übereinstimmung leben will (auch das ein Leiden der Moderne) von alledem so mitgenommen ist, dass sie schwer erkrankt. Solche Somatisierung psychischer und religiöser Konflikte sind für Menschen von heute medizinisch schwer vorzustellen. Ich muss allerdings an die Entstehung der Hysterie als einzigen Ausweg überforderter Frauen im 19. Jahrhundert denken, die Thomas Szass so schön dargestellt hat. Psychodruck plus Korsett – das muss toxisch gewirkt haben. Immerhin merkt sie an Felix‘ Krankenpflege: er liebt sie trotzdem. Entscheidende Worte spricht am Ende der raubeinige Vater: auf dem Land ist der Gott-Vaterglaube ganz natürlich- aber muss auch manchmal erkämpft werden: Gegen den unüberwindlichen Zweifel hilft nur: an anderes denken, mit Bescheidenheit und Entsagung. Jeden Tag die Pflicht tun.
Da haben wir den Kladaradatsch: Es bleibt für den Glauben nur, den Zweifel anerkennen und tapfer weitermarschieren. Das Heldentum des Protestantismus, in dem der Zweifel zum Ausweis der korrekten Zugehörigkeit wird.
Bd 2
Ab Buch 3 kommt als neuer Lebensbereich der Hof eines Duodezfürsten hinzu. Und auch hier entwickelt Freytag meisterhaft – wie in Soll und Haben die Welt der Großkaufleute, des Landadels, der Juden und Slawen – nach der Großbauernwelt und der Uni-Welt in Bd 1 die ganz eigene Kultur des Kleinherrschers und seiner Entourage. Vieles ist da bestimmt Bildzeitungs-Niveau, aber selbst das beruht ja auf teils schöner, teils beschämend hundsgemeiner Erfahrung. Mir jedenfalls schien das alles historisch durchaus glaubwürdig, wenn auch überzeichnet. Der clash of civilizations im Gespräch zwischen Fürst und Professor über des Tacitus Diagnose zur Degeneration autokratischer Herrschaft ist psychologisch gelungen, denn hier lernt der Fürst sein eigenes Schicksal an die Wand gemalt. Faszinierend auch die Person des Obersthofmeisters, der die Treue zum Fürsten genau dann außer Kraft setzt, als dieser Fürst dem Wohl seines Landes nicht mehr dienen kann, weil geistig-moralisch zerrüttet. Auch sein Gespräch mit Professor über den Untergang der aristokratischen Welt, die schwinden muss, für die aber nix Besseres nachkommt – das ist kolossal. Ansonsten alles voll spannender Liebes- und Betrugsgeschichten, am Schluss ein bisschen viel Hochwasser, Blitz und Donner, die Handschrift verduftet, weil zerstört, und Professor hat dazugelernt, wie er sich von seinem Ehrgeiz und seiner Eitelkeit hat von der Pflicht gegenüber seiner Frau ablenken lassen. Eindrucksvoll auch der Lernprozess von Ilse, die mit ihrer gutherzigen Naivität sich am Fürstenhaus eine blutige Nase holt. Der Schluss wickelt dann alles wieder schön in marzipanenen Kitsch ein: Ärgerlich die Anleihen beim Geistermumpitz des Wanderers mit den Teufelshunden, der Rückgriff auf Ilse als Sächsin, die den halbtoten Fürst bei Regen nicht ins Vaterhaus lässt und dafür selbst die Nacht in der Grotte als dem gesuchten – aber enttäuschenden Schatzort verbringt und dort – passend kommt ihr Professor durch den Wald spaziert – auf Heublumen mit Sohn beschenkt wird.
Trotz meiner stilistischen Bedenken: da ist viel historisch und geistesgeschichtlicher, aber auch moralischer Stoff drin zum Diskutieren und sich-Bilden, und insofern ein Lohnendes Buch (und ungeheuer spannend, auch wenn das Liebesgedudel manchmal peinlich ist).
Hist, Jg
Info
| Erscheinungsjahr | 19. Jh., 2. Hälfte |
| Seiten | 300-600 |
| Autor | Freytag, Gustav |
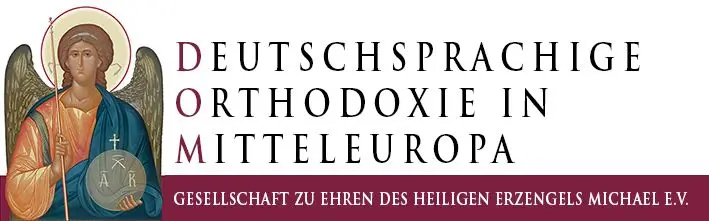
Kommentar zu: Freytag, Gustav – Die verlorene Handschrift.