
(1815 | 380 S.)
Meinung
Cornelia meint:
Der Anfang mit der Jugend des Verfassers und seinem Eintritt ins Kloster ist ganz orthodox. Auch die Darstellung des Lebens dieser Kapuziner: Gemütlichkeit und Friede, und der Probst hat die Herzens-Einsicht. Aber dann: schon vor Eintritt hatte er mal ein Mädel begehrt, und das war die erste Öffnung für den Teufel. Nun kommen Zweifel an Reliquien dazu, als nächstes der Stolz mit Hilfe des Teufels selbst, der ihn besessen hält, zuerst mit Verblendunng, und dann mit allen anderen Lastern. Grauslich, aber als Diagnose der Verblendung und ihren Folgen auf der Höhe eines Johannes Cassianus. Eindrucksvoll. Dann aber wird das Teufelswesen mit all seinem inneren Widerstreit durch verschiedene Personen inklusive nervig verrückter Doppelgänger (alias Bruder des Erzählers vom Teufels-verschriebenen Vater) dargestellt, Liebe, Hass, Mord, Totschlag. Wer will sowas lesen! Gewiss gibt es viel literarische Kostbarkeiten auf den Weg gestreut. KunstTheorie, Psychologie der Verdoppelung bei satanischer Besessenheit, aufgeklärter Absolutismus, Bedeutung des Adels in bürgerlicher Gesellschaft, Augustins Prädestinationslehre und Assoziation von Begehren mit Sünde, Mischung von Spiritualität mit Sinnlichkeit, Notwendigkeit des Bösen…Da fehlt krass die Nüchternheit und es wird miefig parfümiert vatikanisch (obwohl der Papst mit seinen Dominikanern auch sein Fett wegkriegt). Ein Zeugnis west-christlicher Verblendung wie schöner nicht geht. Und natürlich ganz große Literatur. Aber wer will sich sowas (außer zu Diagnosezwecken für wissenschaftliche Arbeiten) zumuten?
Info
| Erscheinungsjahr | 19. Jh., 1. Hälfte |
| Seiten | 300-600 |
| Autor | Hoffmann, E. T. A. |
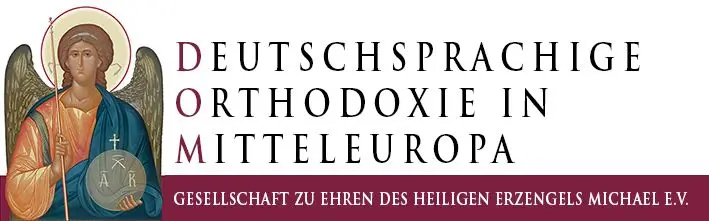
Kommentar zu: Hoffmann, E.T.A. – Elixiere des Teufels.