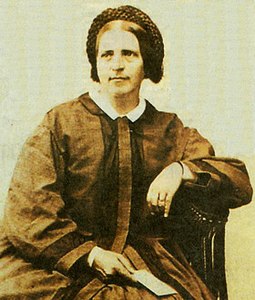
(1870 – 1900) Johanna Spyri, gebürtig Johanna Louise Heusser war eine Schweizer Kinder- und Jugendschriftstellerin. Sie ist die Schöpferin der bekannten Romanfigur Heidi. Wikipedia
(Bild: Wikipedia)
Meinung
Cornelia meint (GK = für größere Kinder, JG = für Jugendliche):
Bei Spyri ist so manche Familie kaputt, aber Gott gibt Trost für die Opfer.
Gritlis Kinder : wo sie hingekommen sind 1883
Ziemlich straightforward schön, wie Klarissa die schwindsüchtige Nora auf Sehnsucht nach dem Tod vorbereitet, dem sie eh verfallen ist. Und wie sie nach diesem Tod ihrer eigenen Mutter erst das Elsli, und jenes dann den Bruder Fani als Adoptionskinder nahelegt. Klarissa ist eine Art guter Geist, der alles regelt. Irdischer geht es im Doktorhaus zu, wo aber auch eine Tante für guten Rat nach allen Seiten sorgt. Beklemmend die Industriellenfamilie Bickler, die schon bei Geburt jedes Kindes im Dorf dessen künftige Arbeitsleistung in Rechnung stellt. Diese ganze Familie, das sind die Bösewichte. Stiefmutter Margaret ist halt verhärtet, lässt sich für Geld der beiden Stiefkinder gern zwecks Adoption entledigen. Die Kinder der Doktorfamilie sind auch etwas arg schematisch.
Also die Jenseits-Hoffnung, die auch dem Naturwissenschaftler-Kind an Raupe und Schmetterling klar wird, das alles ist schön und wertvoll. Sonst etwas simpel.
GK
Gritlis Kinder: kommen weiter 1884
Ärgerliches Buch. Nur damit die drei größeren Arztkinder lernen, weniger eigensinnig zu sein, muss Elsli sterben. Das Kind wurde bei Frau Stanhope, der gütigen Adoptivmutter aus dem früheren Buch, leider wohlstandsverwahrlost, während Bruder Fani seine Gönnerin brav und opferwillig beglückt. Dabei verlangt er von der Schwester die, gleiche Zuvorkommenheit (immer heiter sein, Erwartungen befriedigen), aber die kann das nicht und leidet. Tante Klarissa geht im Management des Hauses auf und merkt nicht, wie das Kind immer kränker, schwächer und trauriger wird. Das Kind entdeckt endlich eine arme Familie, von der sie – wie daheim – sich gebraucht fühlen kann, hier aber, anders als daheim, mit viel Dankbarkeit. Das beschert ihr nochmal ein Aufflackern der Lebensfreude, dann ruckzuck, Blutsturz, aus.
Die tiefe Problematik dieser Adoption müsste man mit Kindern besprechen. Am Ende lässt die Adoptivmutter den Fani Künstler werden, wie er immer wollte. Nagut, da hat sie was gelernt. Aber das andere Kind bleibt tot.
Ungut finde ich auch für Kinder diese Opfer-Ideologie. Elsli ist nichts als lieb für alle und schwach und liebevoll tüchtig – und Opfer. Punkt. Alle Personen sind Schemata.
Und das Christentum wird zwar schön weitergegeben, im vorangehenden Band von Klarissa zu Nora und von da zu Elsli, dann jetzt von Elsli zum Großvater der armen Familie und beim halben Ertrinken im Rhein zu Emmi und Fani. Aber es ist schon sehr ein Deckel für jeden Topf.
Nicht zu empfehlen.
Toni vom Kandergrund
Glückliches Zuhause, Vater stirbt. Damit scheitert, für Söhnlein der Traum einer Holzschnitzer-Lehres am Geld. Er muß auf die Alm wo er vor Einsamkeit verkommt und von Gewittern traumatisiert wird. Aber in der Heilanstalt trifft er eine Frau, deren Sohn gestorben ist. Die hilft. So schafft er es against all odds, endlich doch noch Holszschnitzer zu werden
Ziemlich grauenhaft die Beschreibung der Zeit als Almhüter: völlig isoliert, mangelhaft ernährt, und beim Gewitter in Todesangst mit bleibendem Schock.
Wie so oft kommt eine dea ex machina, eine Frau, die ihr Kind verloren hat und nun zur Retterin wird. Und wie so oft wird das Gebet zur Wende, denn nur das von der verwitweten Mutter täglich mit Tränen am Bett des Kindes gesprochene Gebet kann das beschädigte Hirn dieses Kindes erreichen. Es gibt also die innerliche neben der äußerlichen Rettung.
Die Erzählung ist gut, weil sie die Menschen beschreibt, wie diese sind, also keine Stereotypen macht, – wenn man von der Idealität der Frauen und des Pfarrers absieht. Das soll zeigen, dass die besten Menschen nix machen können gegen die Armut. Es geht um die Armut.
GK
Beim Weidenjoseph
Eine sehr bewegende Geschichte, wenn auch bissel penetrant gemacht. Frau stirbt, Mann Sepp gerät auf Abwege, Kinder bleiben in Armut bei Großeltern. Sollen aber doch beten, sagt der Pater bei der Kapelle. Sie lernen die Kinder des Oberamtmanns im Nachbarort kennen, nur kurz. Dort geht durch die Schuld der Tochter das Schäfchen verloren. Die armen Kinder finden es und der Pater zieht es auf.
Dann wird Papa Sepp beim Amtmann verklagt, aber der Pater legt gute Worte ein. Erwähnt das Schaf. Höhepunkt Weihnachten: Die armen Sepp- Kinder dürfen Schaf zur Amtmannsfamilie bringen, wo Tochter inzwischen gebeichtet hat, wie das Schaf verlorenging. Sepp, der inzwischen für den Amtmann arbeitet, sieht dort seine Kinder wieder, bringt sie heim, Versöhnung mit den Großeltern. Alles Butter.
Ungeschickt allerdings, wie nach der Darstellung des Weihnachtsfestes nach-erzählt wird, wie der Pater das alles hingedeichselt hat. Das hätte in den Prozess eingehen sollen. Vermutlich dachte Spyri, sowas würde die Kinder überfordern.
Trotzdem eine schöne Geschichte.
GK
Aus dem Leben
Marie
Das ist die schönste und dichteste Erzählung. Marie wächst bei Missbrauch-Mutter auf, wird verletzt, in ein Rettungshaus gebracht. Zuhause hatten die Lilien sie immer getröstet. Bei einem Ausflug der Kinder schenkt ihr eine Frau eine Lilie, die sie mit heimnimmt. Die Hausmutter, wütend, weil alle spät kommen, zerbricht die Lilie. Daraufhin kann Marie ihr nicht mehr gehorchen. Immer bittet sie Gott, der Hausmutter auch was Böses zu tun.
Größer geworden, wird sie in ein gutes Bauernhaus vermittelt. Irgendwann träumt sie, im Himmel zu sein und darf dort keine Lilien dort sehen wegen ihrer Rache-Gebete. Da lernt sie „wie auch wir vergeben“ und lernt beten. Sie kommt in Arbeit, kriegt TB und stirbt. Kurz vorher hat sie aber der Autorin, die ihren Weg seit Rettungshaus aus der Ferne begleitet hatte, alles erzählt.
Wunderschön, weil theologisch völlig richtig, und auch wegen der zartfühlenden Art, wie mit einem verletzten Kind umgegangen wird. Niemand fragt, niemand dringt da rein. Erst als sie selbst von früher spricht, fragt die Autorin weiter und erfährt.
GK
Daheim und in der Fremde
Die Tochter im Pfarrhaus hat alles bekommen, was wichtig ist, schöne Natur und die Bibel und viel Liebe. Aber ihr Wissensdurst geht darüber hinaus. Und sie findet es armselig, aus Gnaden anzunehmen, was mit eigener guter Kraft erarbeitet werden kann. Damit kommt sie nicht an. In der Meinung, dass sie, im Gegensatz zum Rat der Eltern, weiß was sie braucht, heiratet sie einen Mann, der schon auf dem Weg zur Demenz ist. Beider Kindlein stirbt, hat ihr aber – angeleitet von Magd Rosine – noch die Bibel nahegebracht, von der sie sich eigentlich doch immer ferngehalten hat. Im Schmerz sprechen die Psalmen zu ihr und sie erlebt Reue, Umkehr, alles paletti als der Mann dann auch stirbt, den sie brav ertragen hat. Da kehrt sie heim und pflegt die Eltern, und dann stirbt sie auch.
Geistlich gesehen ist da nix dran auszusetzen. Das Problem ist, das Unrecht der Eltern zu durchschauen, die meinten, wenn sie der Tochter das Beste geben, dann ist das perfekt. Sie verstehen nicht, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Sie haben die Wissbegierde des Kindes nicht gefördert. Natürlich hat Spyri schon bei Sarah gezeigt, dass das weltliche Wissen nur Einbildung nährt. Aber so lieblos hätte das der Heilige Johannes Chrysostomos nie vertreten.
Aus früheren Tagen 1873
Auch Klara wird aus dem Blickwinkel der Freundin-Autorin vorgestellt wird. Anders als Sarah im Ihrer keines vergessen wird ihr keine Bekehrung zuteil. Immerhin, liest sie weiterhin in der Bibel.
Eine erste Freundschaft verbindet die Autorin mit Marie vom Hennenhof. Ein Bergdorf mit Kindern zwischen Kirche und Wiedertäufern, zwischen selbstgerechtem Pharisäertum und wirklicher Güte. Marie läßt sich zu den Wiedertäufern locken, die Autorin hat da ihre Reserve und traut mehr auf Mutter und Großmutter Maries und den neuen Pfarrer. Allerdings will Marie nur hin wegen Johannes. Es ist aber nicht Johannes, sondern Rüpel Rudi, der dem armen Meieli durch den Schnee hilft und große Opfer bringt, bis sie trotzdem stirbt, allerdings verklärt.
Alle Kinder sind normale Schlingel, nur Lise Tugendwächter tyrannisiert alle.
Dann kommt Johannes Base Klara ins Dorf der Autorin und befreundet sich mit ihr, die sie ohne Ende bewundert, weil gebildet. Beide ab in verschiedene Erziehungsinstitute. Nach drei Jahren hat Klara Gedichte von Vetter Johannes mitgebracht, den sie vergöttert, während Autorin nix an ihnen findet. Inzwischen nämlich hat sich die Lise sich den lieben, schwachen, dabei etwas zu stolzen Johannes geschnappt. Der hatte eigentlich Marie geliebt, war aber zurückgeschreckt vor der Ablehnung durch deren reichen Vater. Marie macht eine schlimme Depression durch. Es ist das Mitgefühl mit Marie, das der Autorin den Geschmack an jenen Gedichten nimmt. Auch Klara liebt den idealen Jüngling, aber als Spielboy und seine Ideale nur als Kultur.
Marie hat über dem Schmerz ihren Glauben verloren. Klara zeigt sich herzlos: Hätte Marie mehr Bildung, ginge es ihr besser. Die Beziehung zu Klara zerbröselt. Aber Marie fängt sich und ist jetzt gefestigter als je zuvor, wo sie noch alles ausprobieren wollte.
Klara kommt und bekennt schweres seelisches Leid: Die Sache mit ihrem Schwarm ist nix geworden. Und jetzt will sie sich halt nützlich machen, auf ihre irdische Weise, ohne Freude. Verzicht als Lebensrettung. Will wissen, wieso Marie sich gefangen hat und muss dafür versprechen, in der Bibel zu lesen. Dann erfährt sie: Marie hat am Grab der Großmutter um Hilfe gebeten und dann richtig beten gelernt. Besonders lernte sie, dass Hilfe nicht von außen kommt (von Wiedertäufern) sondern von Gott. Allerdings nur durch die Reue. Dann hat sie zur Bibel gegriffen. Und alles wurde so viel besser als sie je gewünscht hatte.
Hier bleibt eine gewisse Härte darin, daß Klara noch einen eigenen Weg wird gehen müssen.
Marie hat durchs Tränental und die Reue ihr Ziel erreicht. So wie Sarah in „Ihrer keines vergessen.“ Hier aber bleibt die Autorin anonym, nicht wie Nelly. Kein Wort von ihrem eigenen Weg. Nur abspiegeln, was andere erleben und mitteilen. Insofern ist es aber auch eine Lerngeschichte für die Autorin, die für die Leser steht. So wie Autorin lernt, so sollen die Leser, und alle lernen an den Lernschicksalen von Marie und Klara
GK Mädchen
Ihrer keines vergessen 1873
Nelly Arzttochter mit natürlichem Mitgefühl hilft allen und soll den jähzornigen Waisenjungen Roby behüten. Der aber wird nach Tod seiner Mutter vom bösen Vater mitgenommen werden soll. Nach Amerika – und Nelly malt dem unglücklichen Kind ein Schiff. 10 Jahre später lernt Nelly, immer noch im Krankenbegleitdienst, die hochbegabte und inspirierende gebildete Sarah kennen. Deren Leben reich und voll war, mit Freunden am Rhein, wo die kranke Emma bald stirbt. Sarah fühlt sich dort auch wegen Bewerber Heinrich wunderbar, nur macht die Frömmigkeit der Familie ihr Angst. Ideale Menschen, aber zu religiös. Sie wollen alles aus Gottes Hand haben, und das will Sarah nicht. Sie fürchtet, dass ihr reiches Erdenleben da Einbußen erleidet. Nelly kann bei sowas nicht mit, sie leidet immer noch unter dem Verlust von Roby. Und Sarah findet, dass ihr die Freude am netten Besuch verdorben wurde mit der traurigen Geschichte.
Plötzlich erkennt Nelly Roby in einer Männergruppe, ist sich aber nicht sicher. Sarah hindert sie am Nachforschen. Jedenfalls versteht sie all die Sorgerei nicht. Sie selbst fürchtet sich vor Heinrichs fordernder Milde und Demut als Sünder vor Gott. Er durchschaut sie schmerzlich. Sie sieht sich als Störfaktor bei diesen Leuten und will doch ihr Wesen festhalten. Dann stirbt Heinrich, und Sarah findet sich umschattet. Sie erkennt ihren Egoismus. Reue. Wird Krankenpflegerin – und – geläutert. Hat sich dem Leiden geöffnet. Hat alle Selbstsucht Gott übergeben und Frieden gefunden. Sie hat das persönliche Verhältnis zu Gott gefunden, das sie früher so ängstigte. Die Wandlung kam durch die Begegnung mit einer Mutter, die vom Tod ihres Kindes traumatisiert war. Da hörte sie auf sich zu sehen und sah andere.
Am Ende bekehrt sie noch Roby kurz vor dessen Tod als Verbrecher. Das schafft sie, weil sie Nellys Freundin ist und alles weiß.
Das ist eine sehr ergreifende Geschichte, auch deshalb, weil Nelly die Hauptperson ist, die aber zugleich nur Spiegel ist für die andere Hauptperson Sarah. Nelly hat die Mitte der Seele von vorneherein erlangt, Sarah muß erst durchs Tränental gehen. Der Leser weiß viel mehr als die naive Nelly, er kann aber auch bei ihr bleiben. Das ist richtig gut gemacht.
Der Spiegel, den Nelly für Sarah darstellt, ist ein tief empfindender, bereit für Identifikation des Lesers, auch wenn Nelly sich selbst ganz kritiklos mit Sarah identifiziert, die der Leser viel kritischer sieht. Das gibt für den Leser den doppelten Lerneffekt.
Das ganze ist eigentlich ziemlich proto-orthodox.
JG+ Mädchen
Ein Blatt auf Vronys Grab 1871
Die Freundin Vrony aus dem Bergort – voller Witz und Klugheit und Freude an der Herrlichkeit der Bergwelt, tief empfunden, so dass selbst dabei sie wie verklärt aussieht. Eigenwillig gegen die Verknechtung an den Vater protestierend, der ihr alle Arbeit der verstorbenen Mutter aufdrückt, in finsterer Stube sie spinnen lässt. Später heiratet sie einen, der ihr die weite Welt verspricht und immer nur prügelt. Sie kann sich wegen des Sohnes nicht umbringen. Im Krankenhaus, kurz vor Tod an ihren Wunden, erzählt sie von ihrer inneren Umkehr zu jener Freude, die sie immer außen gesucht hatte: Der Pfarrer hat sie zu ihrem Mann zurückgeschickt, sie solle sich selbst davonlaufen, nicht dem Mann. Und zu Gott. Das gelang, und sie wurde zu einer Frau, die Schläge erträgt im Gebet. Nach ihrem Tod findet der Mann in die Kirche.
Sehr interessant wie die Autorin von sich selbst als Gefäß der Freude Goethes und Homers aus der Stadt auf den Berg zurückkommt und vom Elend Vronys hört. Aber sie hat – als bloß Gebildete – nichts, was sie diesem Elend anbieten könnte, die ganze Literatur ist da leer. So bleibt sie weg, bis eine Diakonissin in der Stadt ihr erzählt von der Patientin aus dem Heimatort. Mich hat berührt Spyris Verständnis für die Eitelkeit der Literatur-beschworenen Heiden-Wonne.
Das ganze ist völlig im Geist der Orthodoxie. Da ist eine Seelenverwandtschaft.
JG+
Arthur und Squirrel 1888
Wunderschön zu lesen, aber! Das Schicksal des heimatlosen Waisen aus dem Pfarrhaus und der verwaisten Fabrik ist einfach zu perfekt koordiniert. Der arme Arthur wird durch Vormund in grässliches Internat gebracht, wo er sich total idealisch edelmütig erweist und einen unterdrückten Jungen rettet, der dann ihn in die Familie eigenen Vormunds einlädt. Und da wohnt im Oberstock als Menschenfeind genau der verlorene Fabriksohn, der Arthurs Onkel ist und von jenem bekehrt wird. Und alles löst sich in Wohlgefallen auf, weil die achtjährige Haustochter Squirrel ein Chaot des guten Herzens ist und neben viel Verwirrung Anlass für gegenseitiges Erkennen bietet und ca. 5 Leute in der Schweiz mit Arthur zu Gott zurückführt und füttert. Solche Ideal-Kinder sind einfach nicht hilfreich für reale Kinder, finde ich. Auch die launigen Erziehungsreden von Squirrels Vater und Onkel Eduard, die das miese Hauslehrerfräulein Malwe zur Lockerheit gewinnen wollen. Das kann man heute nicht mehr lesen. Und viel Frommes als Dreingabe….
Interessant allerdings ihre pädagogischen Bemerkungen als Hinweis auf Reform des Erziehungswesens: Ersetzung der Anpassung von Kindern an Erwachsene durch Verständnis für kindliches Empfinden – da ist Squirrel ein Lehrstück für alle verzweifelnden Lehrer. Denn sobald ihr gutes Herz motiviert ist, lernt sie einfach alles. Also Einfühlung statt drüber-weg-Regieren.
Wenn man andererseits die Figur des Arthur unwahrscheinlich findet – wie soll das sanfte Bübli die Bärenkräfte bekommen haben, um den grausamen Eber zur Vernunft zu würgen – wird man sich an Heiligenviten erinnert. Vielleicht haben wir es hier mit einer protestantischen Form der Heiligenlegende zu tun. Er wird ja auch Pfarrer und evangelisiert schon mit 12.
Wie Wieselis Weg gefunden wird
Das ist eine ganze Strecke reifer als Silser und Gardasee. Ein ganzes Dorf wirkt mit, und die Vorgeschichten der Erwachsenengeneration aus den Kindertagen werden sehr klug kommuniziert, so dass man nie das Gefühl hat, es knirsche. Die Spannung mit dem Raubüberfall ist wirklich gut gehalten, damit erhält das ganze einen unheimlichen Hintergrund, der die normale Inhumanität der Götti-Familie gegen die bestrafte Dummheit der Mutter von Wieseli und die engelgleiche Güte von Andreas und der guten Herrschaft der Ritter-Familie nochmal kontrastiert.
Es ist aber schon bemerkenswert, dass hier wie in Heidi das höchste Glück eines verlorenen Mädchens darin besteht, von irgend welchen Alten Männern gebraucht zu werden. Vielleicht gibt es sonst keine plausiblen (Frauen machen selber) und unverdächtigen (junge Männer scheiden aus) Nachfrager verfügbar sind. Auch ist stets das Erbe gesichert, was für alle Zukunft eine Startposition absichert.
GK
Am Silser und am Gardasee
Alles wunderschön, bloß man fühlt sich manipuliert, wenn Informationen so künstlich zurückgehalten, Fragen nicht gestellt werden. Nur so können ja Jahre der Entsagung die armen Helden von ihrem verdienten Glück abhalten. Das macht einen Groschenroman-Eindruck, und die ganze Ergebung an Gott wird allzu sehr von der Autorin verwaltet. Sie steht zwischen Seiner Gnade und der Verzweiflung der Menschen. Ne aber! Da mangelt irgendwas an Wahrheit.
Allerdings zugegeben: Der soziale Aufstieg für Stineli wäre zu abrupt, um ihr gut zu tun. Sie wäre auch noch zu jung gewesen, um gleich mitzukommern. Insofern hat Spyris Gott das ganze schon optimal geregelt.
Am Felsensprung 1886
Flößer in Wildwasserschlucht, Frau Marthe in Arbeit abgetaucht, merkt gar nicht, dass ihre Tochter (Lichtgestalt Feieli, 10, Schwindsucht) so langsam stirbt. Die beiden kleinen Brüder, auf die sie aufpassen soll, sind reine Ekel. Nur Bruder Jo beschützt sie. Die Alte Silvia lehrt die beiden Großen beten, Marthe selbst will das nicht. Die Alte hat Sohn verloren, reuig wiedererhalten, viel Elend ausgehalten, steht aber fest im Glauben. Dann kommt noch als Retterin eine Besucherin, die gleich merkte, wie es Feieli geht und nachher dem Jo eine Lehrstelle verschafft. So kann der seinen Mechaniker-Traum realisieren, worum Feieli schon bei Gott gebeten hatte. Am Ende lernen beide Eltern beten. Man hat also wie im Heidi die spirituelle Großmutter vor Ort und die tatkräftige Helferin, die auch was bewegen kann, weil sie von außen kommt.
Eigentlich ein vollwertig geistliches Buch.
JG+
Heidi 1880 und 1881
In einem durchgelesen. Man kann sich nicht lösen. In der Frankfurter Periode wieder wie als Kind Rotz und Wasser geheult. Es ist aber auch wirklich zu grausam. Mir natürlich steht der Öhi am nächsten. Dete meint es immer gut und sieht immer ihren Nutzen auch dabei. Heidi ist von einer Rousseau-ischen Unschuld und Güte. Das ist schon ein bisschen arg. Sie muß sehr streng erzogen sein, denn sie kennt keinen Ungehorsam. Zugleich ist sie voller Liebe und Mitgefühl, was unwahrscheinlich ist, so wie sie niemals viel Liebe bekommen hat.
Aber egal.
Es wird mir ein bisschen zu viel gesprungen und gerannt. Das Kind wird so sehr plakativ dargestellt und wächst auch durchaus nicht in den 2 Jahren. Nur Peter gegenüber wird sie strenger und fordernder.
Also – es gibt durchaus literarische Mängel. Auch dass der alte Doktor sich nachher ein „Recht“ auf das Kind erwerben will, klingt gruselig. Alle saugen an Heidi als Lichtgestalt.
Schön die christlichen Lehren der Großmama und die christliche Empfindsamkeit der Großmutter. Da ist das Buch geradezu orthodox. Pietistisch halt.
Richtig sieht Klaus Doderer, dass unklar bleibt, ob die Natur selbst göttlich sein soll oder Gott in der Natur sichtbar wird. Da ist beim Rauschen der Tannen was dran. Und Heidi eine Art Heuschrecke, die hüpfend Gott lobt. Als Kind hab ich diese Stellen auch überlesen, war nur in der Frankfurter Phase voll dabei.
Für die Lehr und Wanderjahre fragt man sich natürlich: Welchem lesenden Kind kann sowas helfen, wenn ein Naturwunder von allen Seiten gequält wird? Das befördert doch nur schlechte Identifizierungen. Der zweite Teil „kann brauchen, was es gelernt hat“ ist dann schon interessanter, besonders für die Heilung von Klara. Aber auch da bleibt Heidi eine Projektion ihrer Autorin.
Entsetzlich peinlich zu sehen, was aus dem Schwaller-Original Heidi geworden ist. Genießt den Ruhm, hat ihren Manager, später den Peter geheiratet, der aber trank, und sie schlürft heute Sekt in ihrer Alten-Residenz. Brr.
GK unter Vorbehalt
Info
| Erscheinungsjahr | 19. Jh., 2. Hälfte |
| Seiten | 300-600 |
| Autor | Spyri, Johanna |
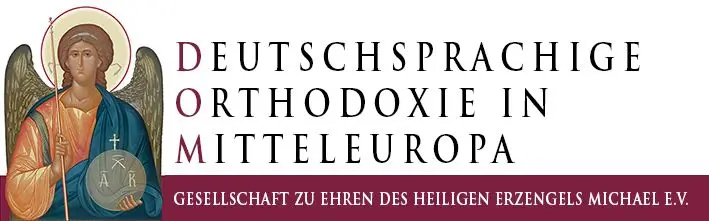
Kommentar zu: Spyri, Johanna – Kinderbücher.